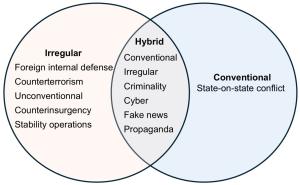„Schützen, versorgen, durchhalten“ – Das neue Unterstützungskommando der Bundeswehr
Interview mit dem Befehlshaber des Unterstützungskommandos, Generalleutnant Gerald Funke
Generalarzt a. D. Dr. Andreas Hölscher und Rainer Krug
Das neue Unterstützungskommando wurde am 1. Oktober 2024 in Dienst gestellt und erreichte zum 1. April 2025 seine volle Einsatzbereitschaft. In diesem Exklusivinterview erläutert der Befehlshaber des Kommandos die Rolle, Struktur und Herausforderungen dieser neuen Formation innerhalb der Bundeswehr.
WM: Herr General, am 1. Oktober 2024 wurde das neue Unterstützungskommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Sie sind der erste Befehlshaber dieses Kommandos. Wie würden Sie in kurzen Worten Ihren Auftrag beschreiben?
Generalleutnant Funke: In ganz kurzen Worten, wenn ich es wirklich in einem Satz sagen müsste, würde ich sagen: „Schützen, versorgen, durchhalten.“ Das ist nicht nur unser Motto, sondern beschreibt präzise unseren Kernauftrag.
WM: Könnten Sie uns etwas zur symbolischen Bedeutung des Wappens und Logos Ihres Kommandos erläutern?
Generalleutnant Funke: Unser Wappen ist relativ einfach gehalten. Es kombiniert die Farbe Berry-Rot, die uns vom Ministerium vorgegeben wurde, mit Weiß. Diese Farbgebung ist treffend, wenn man bedenkt, dass viele der bei uns vertretenen Truppengattungen – Logistik, Sanität, Feldjägerei, ABC-Abwehr – einen Berry-Farbton in ihren Kennzeichnungen haben.
Das „U“ im Wappen steht natürlich für „Unterstützung“, und die Schlange symbolisiert den Sanitätsdienst. Unser Logo zeigt symbolisch die Kernbereiche unseres Kommandos: Das Zahnrad repräsentiert die Logistik, das Rote Kreuz den Sanitätsdienst und das Schild den Schutzaspekt. Zusammen stehen sie für unser Motto: „Schützen, versorgen, durchhalten.“
Der Sanitätsdienst bildet mit ungefähr 27.000 Menschen den größten Anteil. Logistik ist der zweitgrößte Bereich. Hinzu kommen die Feldjäger, ABC-Abwehr und das Kommando für Zivil-Militärische Zusammenarbeit, das früher „Multinationales Kommando Zivil-Militärische Zusammenarbeit“ hieß und jetzt einfach „Kommando ZMZ“ heißt. Darüber hinaus gehören zu uns verschiedene Einrichtungen des Streitkräfteamtes – darunter Sportfördergruppen, Militärmusik, Truppenübungsplätze, Familienbetreuungszentren, Jugendoffiziere und Spezialaufgaben wie Munitionssicherheit. Auch das Planungsamt und militärische Dienstposten in NATO- und EU-Verwendungen fallen in unseren Verantwortungsbereich.
Insgesamt repräsentieren wir etwas, was querschnittlich von allen Teilen der Streitkräfte gebraucht wird, aber eine knappe Ressource darstellt. Unsere Systeme sind vielleicht nicht so „sexy“ wie ein Leopard-Panzer, eine Fregatte oder ein F-35-Kampfjet, aber sie sind für die Durchhalte- und Überlebensfähigkeit unserer Streitkräfte entscheidend wichtig.

WM: Zum Stichtag 1. April sollte das Kommando die volle Einsatzbereitschaft erreicht haben. Dann sind sämtliche Fähigkeiten aus den bisherigen Bereichen im Unterstützungsbereich vereint. Wie erfolgt in Ihrem Kommando die Koordination dieses mit über 55.000 Dienstposten gigantischen Unterstützungsbereichs?
Generalleutnant Funke: Es ist wichtig, das Unterstützungskommando im Gesamtzusammenhang der Reorganisation der Bundeswehr zu betrachten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Reorganisation ist, dass aus zwei operativen Säulen – dem Einsatzführungskommando und dem Territorialen Führungskommando – eine Säule, das Operative Führungskommando, geschaffen wurde. Mit dem Operativen Führungskommando beschränkt sich diese Ebene auf die rein operative Führung. Die taktische Führungsebene wurde den militärischen Organisationsbereichen zugeordnet: Alles, was „Land“ dominiert ist, liegt beim „Land-Component-Command“, das bedeutet, beim Kommando Heer in Straußberg. Alles, was „Luft“ dominiert ist, bei der Luftwaffe, und alles Maritim dominierte bei der Marine sowie alles, was Cyber betrifft, beim Kommando CIR.
Die Rolle, die meinem Kommando zukommt, ist vor allem die eines Medical Component Command. Wir führen sanitätsdienstlich orientierte Einsätze auf der taktischen Ebene – beispielsweise bei Naturkatastrophen wie einem Tsunami oder Erdbeben, wo der Sanitätsdienst im Mittelpunkt steht, unterstützen aber auch bei Operationen von Kräften des Heeres, der Luftwaffe oder Marine. Die besondere Herausforderung bei diesen Einsätzen ist, dass wir vergleichsweise wenig Vorwarnzeit haben. Ein Erdbeben oder Tsunami kündigt sich in der Regel nicht lange vorher an. Wir müssen also von „jetzt auf gleich“ einsatz- und reaktionsfähig sein.
Eine zweite wichtige Rolle ist die Verwundetenversorgung. Nehmen wir als Beispiel einen Einsatz in Litauen: Falls es dort zu einem Konflikt käme, müssten wir mit vielen Verwundeten rechnen. Die Rückführung der Verwundeten und ihre Verteilung im zivil-militärischen Kleeblatt-System würde durch unser Kommando koordiniert, da hier die Zusammenarbeit mit zivilen Leistungserbringern wie dem Malteser Hilfsdienst, Krankenhäusern und BG-Kliniken eine wichtige Rolle spielt.
Die dritte Rolle, die oft übersehen wird: Wir sind das Fachkommando für den Sanitätsdienst. Die sanitätsdienstlichen Standards werden durch meinen Stellvertreter vorgegeben, der gleichzeitig Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes ist.
WM: Der Sanitätsdienst stellt den größten Bereich in Ihrem Kommando, und Ihr Stellvertreter ist gleichzeitig Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes. Wo liegen die Schnittstellen in der gemeinsamen Zusammenarbeit, und wo sind die Verantwortungsbereiche klar getrennt?
Generalleutnant Funke: Bei der neuen Struktur geht es nicht darum, die Sanität zu beschneiden oder zu behaupten, sie hätte bisher schlechte Arbeit geleistet. Im Gegenteil: Die Sanität hat eine hervorragende Qualität und steht auf einem ausgezeichneten Standard. Das gilt auch für alle anderen Fähigkeitsbereiche des Unterstützungskommandos. Mein Stellvertreter ist gleichzeitig Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes innerhalb des Unterstützungskommandos und auch wehrmedizinischer Berater des Ministers mit direktem Zugang zu ihm. Die Fachlichkeit wird durch die neue Struktur in keiner Weise negativ beeinflusst – im Gegenteil: Ich glaube, dass die Stimme der Unterstützung zusammen mit dem Sanitätsdienst durch den jetzt größeren Bereich eher an Bedeutung und Gewicht gewonnen hat. Was sich jetzt zusätzlich als Potenzial ergibt, ist die Möglichkeit, in übergreifenden Bereichen Synergien zu erschließen. Nehmen wir die Logistik und den Sanitätsdienst: In beiden Begriffen steckt das Wort „Logistik“ – das ist kein Zufall. Es gibt spezifische Belange des Transports von Sanitätsmaterial, aber die Nutzung von Straßen, Schienen oder anderen Transportwegen ist grundsätzlich gleich, egal ob es sich um einen Kühlcontainer oder einen normalen Container handelt.
Ein anderes Beispiel ist die ABC-Abwehr und der medizinische ABC-Schutz. Hier steckt in beiden Bereichen das Thema ABC drin, und es gibt ein erhebliches Potenzial für Synergien. Auch für den Einsatz hat diese Struktur Vorteile: Stellen wir uns ein begrenztes Gebiet wie Litauen vor. Wenn jeder seinen eigenen logistischen Apparat aufbauen würde, kämen wir in einem solchen Land nicht weit, weil die Geografie zu eng ist. Das Konzept „unter einem Dach“ ermöglicht es, für den Einsatz effektiver und effizienter zu sein.
Wichtig ist: Dr. Hoffmann und ich haben uns nicht so aufgeteilt, dass er nur in alles reinschaut, was mit Sanität zu tun hat, und ich nur in alles, was nicht Sanität ist. Wir wollen beide ein Verständnis für alle Bereiche entwickeln – ich will die Sanität verstehen, und Dr. Hoffmann hat den Anspruch zu verstehen, was Feldjäger, ABC-Abwehr und Logistik umtreibt. Nur so können wir echte Synergien erkennen und vermeiden, in Silos zu denken.

WM: Was ist noch zu tun, damit auch in Zukunft die sanitätsdienstliche Versorgung der Soldaten der Bundeswehr im In- und Ausland auf hohem Standard gewährleistet ist?
Generalleutnant Funke: Der qualitative Standard ist hoch, aber wir müssen an mehreren Stellen arbeiten. Das fängt an mit der materiellen Vollausstattung der Verbände. Auch im Bereich Modernisierung und Digitalisierung – Stichwort digitale Patientenakte – sind wir auf einem guten Weg, stehen aber noch am Anfang. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Anpassung an die gestiegenen Anforderungen. Auf uns im gesamten Unterstützungsbereich werden absehbar höhere Ambitionen zukommen, die die NATO von uns fordert und die wir in Europa mit Deutschland zu leisten haben. Das Thema „Enablement“ – also Unterstützung – muss stärker in den Fokus rücken. Wenn wir darüber reden, dass wir mehr Brigaden des Heeres aufbauen, ist das zwar sinnvoll und begründet, aber es wird nur dann schlüssig, wenn auch der Sanitätsdienst proportional mitwächst. Sonst wird die Schere zwischen Kampftruppe und kampfunterstützender Truppe nur größer.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Thema „Drehscheibe Deutschland“ im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Wir werden es mit wesentlich größeren Umfängen zu tun haben als bisher, auch was potenzielle Verwundete betrifft. Nur wenn wir die Zusammenarbeit mit zivilen Organisationen – vom Malteser Hilfsdienst über das Rote Kreuz bis zu Berufsgenossenschaften und Kliniken – intensivieren, üben und Reserven vorhalten, werden wir dieser Herausforderung gewachsen sein. Mit der Übung „Quadriga 26“ im nächsten Jahr werden wir diese Rettungskette und die zivil-militärischen Schnittstellen proben.
WM: Was würden Sie sich persönlich für den Sanitätsdienst der Bundeswehr im Blick auf die gemeinsame Auftragserfüllung wünschen?
Generalleutnant Funke: Erstens, dass wir von der mengenmäßigen Ausstattung her – und das betrifft nicht nur Material, sondern auch Strukturen und Personal – besser werden. Zweitens, dass wir bei der Digitalisierung vorankommen, und zwar über die Patientenakte hinaus – das betrifft auch die Führungsmittel innerhalb der Bundeswehr und in den zivilen Bereich hinein. Ein Bereich, in dem die Sanität sehr aktiv ist, ist der Patiententransport. Es gibt konkrete Projekte, bei denen wir nicht nur auf PowerPoint, sondern mit echter Hardware einen Patiententransport aus der vorderen Linie realisieren können. Eine Drohne, mit der ich Patienten transportieren kann, könnte auch für andere Transportzwecke genutzt werden – hier gibt es querschnittliches Potenzial.
WM: Herr General, sie haben einmal den Satz geprägt: „Ohne gut ausgestattete Unterstützung keine überlebensfähige Bundeswehr.“ Und in einem früheren Interview sagten Sie: „Logistik gewinnt keine Kriege, aber ohne Logistik gehen Kriege definitiv verloren“. Unsere Fähigkeiten machen Abschreckung glaubwürdig und die Streitkräfte kriegstüchtig. Wo steht das Kommando heute, und was muss noch getan werden, damit wir bei einem Einsatz angemessen reagieren können?
Generalleutnant Funke: Ich bin fest überzeugt, dass wir bei einem heutigen Einsatz mit den Kräften, die wir haben – und das betrifft nicht nur die Sanität – leistungsfähig wären, abhängig natürlich vom Umfang des Einsatzes. Mit Blick auf die Kriegstüchtigkeit – und Sie wissen, dass der Generalinspekteur aufgrund der Bedrohungsanalyse 2029 als Eckjahr genannt hat – müssen wir bei Vollausstattung und Lagerbeständen besser werden. Die Lagerbestände wurden über die letzten 30 Jahre im Zuge der Friedensdividende deutlich reduziert. Just-in-time-Logistik war damals State of the Art und hat Kosten gespart. Diese Lagerbestände müssen wir jetzt wieder auffüllen, was durch unsere Unterstützung für die Ukraine zusätzlich erschwert wird. Diese Abgaben sind aus guten Gründen erfolgt, aber sie bedeuten, dass das Auffüllen unserer eigenen Bestände länger dauert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Lehren aus dem Ukraine-Krieg, besonders im Bereich der Sanität. Die Bergung von Verwundeten auf dem Gefechtsfeld unter permanenter Drohnenbedrohung stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir müssen in Bereiche investieren, die wir bisher nicht so konsequent verfolgt haben: Schutz von Einrichtungen, Beweglichkeit, Skalierbarkeit, Tarnung. Man kann lange diskutieren, ob der Ukraine-Krieg ein Blueprint für künftige Konflikte ist. Diese Diskussion halte ich für müßig – es ist eine Facette, die auftreten kann, und darauf müssen wir Antworten finden.
Eine ständige Herausforderung für die Bundeswehr und besonders für uns ist, dass eine Großorganisation wie die unsere immer Schwierigkeiten hat, auf kurzfristige Innovationen mit kurzen „Versions“-zyklen angemessen zu reagieren. Wir müssen Wege finden, damit etwa ein Facharzt, der auf einer Ausstellung für Sanitätstechnik ein nützliches neues Gerät entdeckt, nicht den klassischen langwierigen Beschaffungszyklus durchlaufen muss. Der Sanitätsdienst hat ja nicht nur ukrainische Sanitätssoldaten ausgebildet, sondern auch direktes Feedback von der Front bekommen. Über 20 Jahre lang haben wir Internationale Krisenbewältigung gemacht – Balkan, Afghanistan – wo die Anzahl der Verwundeten überschaubar war und wir sie mit dem MedEvac-Airbus innerhalb weniger Stunden ausfliegen konnten. In einem konventionellen Konflikt wird das so nicht mehr möglich sein.
Dabei müssen wir besser werden – aber nicht im Sinne von „bisher haben wir alles verkehrt gemacht“, sondern wir müssen aus den aktuellen Gegebenheiten lernen und uns darauf einstellen. Von unserem jetzigen Ausgangspunkt sind wir qualitativ gut aufgestellt, quantitativ haben wir es bereits angesprochen. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen – wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln. Das Mindset, die Denkweise des Militärs, muss sich ebenfalls ändern.
WM: Nicht nur die Bundeswehr, auch unsere Gesellschaft muss kriegstüchtiger werden.
Generalleutnant Funke: Ich glaube, dass der zivile Sanitätsdienst in der Breite weiter ist als viele andere Ressorts. Wenn ich sehe, was auf regionaler und lokaler Ebene bereits läuft, ist da eine Menge Bewusstsein vorhanden. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass wir unsere Verwundeten einfach in den Bundeswehrkrankenhäusern abgeben können.
Das Bewusstsein für einen gesamtstaatlichen, gesamtgesellschaftlichen Ansatz ist im Sanitätsdienst weiter entwickelt, als in vielen anderen Bereichen. Bei dem kürzlichen Symposium „Operationsplan Deutschland“ in München wurde deutlich, wie hoch das Interesse bei Maltesern, Johannitern und dem Roten Kreuz ist, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Es geht nicht darum, ein Eigenleben zu führen, sondern eine gesamtstaatliche Aufgabe zu erfüllen.
WM: Herr General, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen für die vor Ihnen liegenden Herausforderungen viel Soldatenglück und das nötige Durchhaltevermögen.
Das Interview führten Generalarzt a. D. Dr. Andreas Hölscher, Chefredakteur der Wehrmedizin und Wehrpharmazie und Rainer Krug, Chefredakteur des CPM FORUM.
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2 / 2025
Generalarzt a. D. Dr. Andreas Hölscher,
Chefredakteur der Wehrmedizin und Wehrpharmazie
Rainer Krug,
Chefredakteur des CPM FORUM