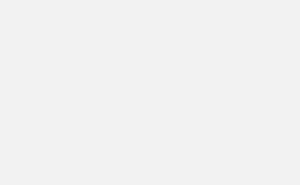Hilfe im Einzelfall und Forderungen im Grundsatz
Interview mit dem Beauftragten für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte im Bundesministerium der Verteidigung
B. Mattiesen
Am 1. Juli 2015 hat Generalarzt Dr. Bernd Mattiesen die Aufgaben als Beauftragter für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte im Bundesministerium der Verteidigung übernommen. Im Interview spricht Generalarzt Dr. Mattiesen über seinen Aufgabenbereich und die Herausforderungen, die ihn begleiten. Das Gespräch führten Gertraud Assél als Verlagsleiterin des Beta-Verlages und Oberstarzt Dr. Kai Schmidt, Chefredakteur der Zeitschrift WEHRMEDIZIN UND WEHRPHARMAZIE (WM).
WM: Herr Generalarzt Dr. Mattiesen, als Beauftragter für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte im Bundesministerium der Verteidigung beraten Sie die Leitung des Ministeriums und geben Vorschläge, wie in der Bundeswehr die Prävention sowie die Behandlung, Betreuung und Versorgung von Einsatzgeschädigten verbessert werden kann. Zudem fungieren Sie als Ansprechstelle für Einsatzverwundete und sind hier vermittelnd und beratend tätig. Wie möchten Sie unseren Leserinnen und Lesern Ihr Aufgabenspektrum beschreiben?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Herzlichen Dank für Ihre Frage. Sie beschreiben damit meinen Aufgabenbereich ausgesprochen gut: Als Beauftragter im Bundesministerium der Verteidigung für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte (kurz Beauftragter PTBS) habe ich eine Doppelfunktion. Einerseits ist es mir ein großes Anliegen, den einzelnen Betroffenen durch Hilfestellung und Beratung den Weg durch für sie schwer überschaubares Terrain zu ebnen. Andererseits gilt es aber, aus den im täglichen Umgang mit den uns anvertrauten Soldatinnen und Soldaten und deren Krankheitsbildern gewonnenen Erfahrungen und den Erkenntnissen aus vielfältigen Gesprächen mit Amtsträgern aller Ebenen grundsätzliche Forderungen für künftige Vorgehensweisen herauszuarbeiten. Beide Aufgabenbereiche erregen auch öffentliches Interesse.
Wir betreuen Einsatzgeschädigte und bieten ihnen ein ganz besonderes Ausmaß an Beratung und Unterstützung in einer Art „Lotsenfunktion“ zum Teil mit intensiven und lang dauernden Kontakten. Hierbei handelt es sich um ein ausgesprochen weites Aufgabenfeld. Neben Fragen der Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung, der Weiterverwendung in der Bundeswehr und möglicher Heilbehandlungen werden wir zum Beispiel auch zum Umgang mit Renten- und Krankenversicherungen oder mit finanziellen Schuldsituationen zu Rate gezogen.
Wesentlich ist für mich dabei, dass es sich eben nicht nur um die oft in den Vordergrund gestellte Posttraumatische Belastungsstörung handelt, sondern völlig gleichberechtigt jede Art von Einsatztraumatisierung bei uns sehr ernst genommen wird.
WM: Sie sind im Sanitätsdienst der Bundeswehr groß geworden. Sie waren in diversen Führungs- und Stabsverwendungen in der Truppe, im multinationalen Umfeld sowie auch im Führungsstab des Sanitätsdienstes im Verteidigungsministerium eingesetzt. Nun umfasst Ihre Verantwortung Facetten aus unterschiedlichsten Bereichen der Streitkräfte und darüber hinaus. Wie konnten Sie sich diesen unglaublich vielfältigen Tätigkeitsbereich erschließen?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Es ist tatsächlich eine Verwendung, in der sich viele Aspekte eines langen Berufslebens zusammenfügen. Es wird häufig gefragt, wie man sich denn als Sanitätsoffizier auf diesem überaus facettenreichen Posten fühle. Dazu kann ich sagen: Sehr passend. Fachlichkeit und Kenntnisse in psychiatrischen Fragestellungen paaren sich hier mit den Erkenntnissen aus ministeriellen und truppendienstlichen Verwendungen, alles angereichert mit etwas Rechtsgefühl. Es ist auch eine Frage der Lebenserfahrung, denn es braucht natürlich Zeit, alle diese Verwendungen zu durchlaufen und diesen großen Wissensschatz zu sammeln.
WM: Sehen Sie Ihre Qualifikation und Erfahrung als Sanitätsoffizier als Vorteil bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Persönlich sehe ich durchaus Vorteile, meinen heutigen Dienstposten als Sanitätsoffizier wahrzunehmen. Meine medizinische Ausbildung erleichtert mir den Zugang zu weiten Bereichen der Versorgung und auch die Entscheidungsfindung erheblich. Im Gespräch mit sozialmedizinischen Gutachtern, Chefärzten und Abteilungsleitern in den Bundeswehrkrankenhäusern nutzen wir dasselbe medizinische Vokabular und haben dabei auch das gleiche Wissen zu hintergründigen Ursachen und mögliche Vorgehensweisen. Die spezielle medizinische Ausbildung des Sanitätsoffiziers erlaubt es dabei auch, therapeutische und sozialmedizinischen Prozesse zu durchleuchten und gezielte Fragen zu stellen.
Ich möchte damit eine ganz klare Aussage verbinden: Die Approbation in einem Heilberuf ist die Basisausbildung des Sanitätsoffiziers. Die weiteren Werdegänge unterscheiden sich dann im Laufe der Zeit erheblich. Insgesamt ist aber die Ausbildung zum Sanitätsoffizier eine ganz hervorragende Schule, um in ähnlicher Weise wie die Absolventen anderer Studiengänge für die querschnittlichen Anforderungen in der Bundeswehr gewappnet zu sein, was die grundsätzliche Eignung von Sanitätsstabsoffizieren für herausgehobene Führungsaufgaben in den Streitkräften einschließt.
WM: Der Beauftragte für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte im Bundesministerium der Verteidigung wurde im Jahre 2010 etabliert. Welche Beweggründe führten zur Einrichtung dieses Bereiches?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Die Auslandseinsätze der Bundeswehr hatten insbesondere mit den schweren Attentaten in Afghanistan ab 2003 und den
später folgenden Kampfhandlungen ab 2007 zu der Erkenntnis geführt, dass auch gut ausgebildete und vorbereitete Soldatinnen und Soldaten nicht nur mit körperlichen Schäden sondern auch mit erheblichen psychischen Veränderungen nach Deutschland zurückkehren können. Während dabei eine wenige Wochen anhaltende akute Belastungsreaktion noch als normal aufgefasst werden kann, stieg die Zahl derjenigen mit anhaltenden tiefgreifenden Veränderungen deutlich an. Es war festzustellen, dass diese Störungen geeignet waren, das persönliche Leben und die Dienstausübung schwierig, wenn nicht in Einzelfällen sogar unmöglich, zu gestalten. Nicht zuletzt unter Beteiligung der Öffentlichkeit verstärkte sich die Einsicht, sich dieser Herausforderung annehmen zu müssen. Auch die hierzu in den Jahren 2009 und 2010 auf dem deutschen Buchmarkt erschienenen Veröffentlichungen von einsatztraumatisierten Soldatinnen und Soldaten trugen zu einem erheblichen Bewusstseinswandel bei. Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehauftritte sowie Gründungen von Hilfsorganisationen und Verbänden durch Betroffene folgten.Es waren dann gerade diese Erkenntnisse, die sowohl einen medizinisch-fachlichen Wissensbedarf weckten und auch die Notwendigkeit für eine sachgerechte und Klienten zentrierte Versorgungsstruktur deutlich machten. Die Themen „Wehrdienstbeschädigung“ und „Einsatzunfall“ bekamen durch die direkt erlebbaren einsatztraumatisierten Soldaten eine ganz erhebliche Neubewertung. Der damalige Bundesminister der Verteidigung hatte sich dann sehr bald entschlossen, einen Beauftragten des BMVg für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte (Beauftragter PTBS) einzusetzen, der die verschiedenen Komponenten wie medizinische Diagnostik und Therapie, fachliche Begutachtung und administrative Maßnahmen in ihrer Gesamtheit nachvollziehen und daraus abgeleitet bestandskräftige Vorschläge für künftiges Vorgehen machen konnte.
Im Ergebnis konnten dann die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch weiter verbessert und die Prozessabläufe in einem ersten Schritt angepasst werden. Insbesondere dem Fürsorgeaspekt musste in zahlreichen Bereichen noch deutlicher Rechnung getragen werden.
Hand in Hand mit dieser Entwicklung ging die Etablierung des Psychotraumazentrums in Berlin, das sowohl therapeutisch als auch wissenschaftlich ausgerichtet ist und beispielsweise auch spezielle Betreuungsseminare für Betroffene, Angehörige und Hinterbliebene anbietet.
Aus heutiger Sicht bleibt festzustellen, dass durch die Einrichtung des Beauftragten PTBS im Bundesministerium der Verteidigung in vielen Fällen eine rasche und bereichsübergreifende Hilfe und unbürokratische Koordination möglich ist. Aus der Summe der Einzelfälle ergeben sich dann Erkenntnisse zur Weiterentwicklung, die auf kurzem Wege eingebracht werden können.
WM: Wie bewerten Sie die Differenzierung zwischen körperlichen und seelischen Einsatzschädigungen? Kann es hier unterschiedliche Gewichtungen geben?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Lassen Sie mich diese Frage einmal von der Seite der Gesundheitsdefinition der Vereinten Nationen beleuchten. Gesundheit wird dort als ein körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden definiert. Vor diesem Hintergrund sollten seelische und körperliche Einsatzschäden fraglos auf gleicher Ebene behandelt werden. Dass dies aber oft nicht so ist, liegt in der Natur der Sache. Körperliche Schäden sind entweder sichtbar oder in aller Regel mit einfachen technischen Mitteln nachweis- und einschätzbar. Seelische Verwundungen müssen zunächst über Gespräche und Testverfahren eruiert und qualifiziert werden. Dabei spielen dann natürlich Empathie und persönliche Erfahrung eine große Rolle. Körperlich verwundete Soldatinnen und Soldaten sind rasch einzuschätzen und erfahren deshalb weniger Akzeptanzprobleme im täglichen Dienstbetrieb. Betroffene mit seelischen Einsatzfolgen sehen sich dagegen oft Misstrauen oder Kritik hinsichtlich der Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung ausgesetzt. Gerade deshalb messe ich allen Bemühungen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen erhebliche Bedeutung bei.
WM: Vor nicht allzu langer Zeit eroberte das Thema Dunkelzifferstudie im Zusammenhang mit psychischen Einsatzfolgen die Schlagzeilen. Wie beschreiben Sie hier die aktuellen Entwicklungen?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Mit der gesteigerten Akzeptanz psychotraumatischer Belastungsstörungen wuchs gleichzeitig auch das Bedürfnis, über ein belastbares Zahlenwerk zu verfügen. Insbesondere ging es auch darum, Vergleichswerte in Abgrenzung zur querschnittlichen Betroffenheit der deutschen Bevölkerung und zu den Belastungszahlen der Streitkräfte Verbündeter zu erhalten. Die Bundeswehr beauftragte nach kurzer Sichtung möglicher Kandidaten den Dresdener Psychologieprofessor Dr. Hans-Ulrich Wittchen mit der Bearbeitung dieser Fragestellungen. In einer nach kurzer Zeit erstellten Querschnittsstudie konnte relativ rasch nachgewiesen werden, dass die psychische Belastung deutscher Truppenteile im Einsatz im Vergleich zu anderen Streitkräften Verbündeter am unteren Ende der Skala liegt. In der darauf folgenden Längsschnittstudie wurden dann die psychische Belastbarkeit von Soldatinnen und Soldaten vor dem Einsatz und mögliche Belastungserscheinungen nach dem Einsatz gegenübergestellt. Insbesondere die letztgenannte Studie wies dann deutlich auf ein Behandlungsdefizit hin. Das Schlagwort hierfür war „Dunkelziffer“. In der Folge dieser beiden grundlegenden und für die damalige Zeit auch bahnbrechenden Studien werden derzeit unter Regie des Berliner Psychotraumazentrums viele weitere wissenschaftliche Arbeiten erstellt. Schwerpunktmäßig nenne ich hier eine Studie zur Abhängigkeit primärer persönlicher Einstellungen und grundsätzlich moralischer Überzeugungen zur Gefährdung durch psychotraumatische Belastungsstörungen und eine weitere Studie mit der Fragestellung, unter welchen Bedingungen eine Soldatin oder ein Soldat bereit ist, sich selbst als betroffen zu offenbaren. Die wissenschaftliche Aufarbeitung psychotraumatischer Belastungsstörungen aus den Einsätzen der Bundeswehr ist somit aus meiner Sicht zwischenzeitlich auf einem sehr effektiven und guten Weg.
WM: Hat das Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan Auswirkungen auf die Krankenzahlen?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Selbstverständlich kann jede Änderung der militärpolitischen Großwetterlage die Krankenzahlen unserer Soldatinnen und Soldaten und die Bereitschaft, sich einer etwaigen PTBS-Erkrankung zu stellen beeinflussen. Afghanistan stand in diesem Zusammenhang sehr lange für das Grundbeispiel eines gefährlichen Auslandseinsatzes. Das Ende des Afghanistan Einsatzes hat aber interessanterweise nur mittelbar Einfluss auf die aktuellen vorliegenden Erkrankungszahlen psychischer und psychotraumatischer Belastungsstörungen. Die Krankheit PTBS besitzt eine ausgesprochen lange Latenzzeit, d. h. sie kann auch erst mit langer Verzögerung auftreten. Ähnliche Erkenntnisse machen die Streitkräfte in anderen Ländern auch. Aber auch eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren, wie gerade auch die vorgenannte Bereitschaft, sich zu erkennen zu geben, spielen eine ganz erhebliche Rolle. Vor diesem Hintergrund befinden wir uns, wenn auch mit gewissen Schwankungen, im Grunde seit Jahren auf einem nahezu gleich bleibend hohem Niveau.
WM: Hat sich die grundsätzlich eher zurückhaltende Sicht- und Verhaltensweise zu psychischen Einsatzstörungen bei betroffenen Soldatinnen und Soldaten sowie bei Vorgesetzten ob der Etablierung des Beauftragten verändert?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Diese Frage kann ich nur bejahen. Wir beobachten in den letzten Jahren einen aus meiner Sicht sehr positiven Wandel sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch in der Gesellschaft. In der Vergangenheit haben sich Betroffene häufig bemüht, sich aus welchen Gründen auch immer zu verstecken. Das nimmt heute nach meinem Dafürhalten deutlich ab. Nach meinem Empfinden findet in der Gesellschaft derzeit ein erheblicher Wandel in Richtung Offenheit und Transparenz statt. Innerhalb der Bundeswehr hat die Einführung von „Lotsen für Einsatzgeschädigte“ erheblich zur Entstigmatisierung beigetragen. Vor zehn, 20 oder 30 Jahren war das noch anders. Zu dieser Zeit wurden Betroffene in der Truppe tatsächlich gelegentlich als „Weichei in die Ecke“ gestellt. Dies erkenne ich heute nicht mehr. Im Gegenteil müssen wir aber auch darauf achten, das Pendel im Rahmen einer falsch verstandenen Fürsorge nicht in die andere Richtung schwingen zu lassen und damit zu einer ungewollten Fixierung bestehender Krankheitsbilder beizutragen.
WM: Wie haben sich Prävention sowie die Behandlung, Betreuung und Versorgung von Einsatzgeschädigten und Einsatzverwundeten seit Einführung dieses Beauftragtenelementes entwickelt?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Im Bereich der Prävention zielt das Rahmenkonzept „Erhalt und Steigerung der psychischen Fitness von Soldaten und Soldatinnen“ vom Oktober 2012 darauf ab, Maßnahmen zu entwickeln, die die psychische Fitness vor dem Einsatz erheben und zu trainieren. Darin sehe ich einen wichtigen Ansatz, der unbedingt weiterentwickelt werden muss. Diese Vorgehensweise hat sich im Pilotprojekt ausgesprochen bewährt. Die Entwicklung der Möglichkeiten zur stufenweisen Umsetzung in der gesamten Bundeswehr steht derzeit kurz vor dem Abschluss.
Die Behandlungsmöglichkeiten für psychisch Verwundete konnten auch durch die verstärkte Einbeziehung ziviler Therapeuten deutlich erweitert werden. Ergänzend werden seit einigen Jahren längerfristige Nachsorgemaßnahmen für Einsatzversehrte und ihre Familien durchgeführt, die sich bewährt haben. Seit 2012 bietet beispielsweise der Lehrgang „Sporttherapie nach Einsatzschädigung“ einen guten Rahmen zur Wiederherstellung und Steigerung der psycho-physischen Leistungsfähigkeit für sowohl physisch als auch psychisch Einsatzgeschädigte. Hierbei möchte ich insbesondere auch die hilfreiche Unterstützung durch die Militärbischofsämter der beiden großen Kirchen in Deutschland erwähnen.
WM: Herr Generalarzt, abschließend eine womöglich zusammenfassende Fragestellung. Welche Schwerpunkte haben Sie sich selbst für Ihr Wirken als Beauftragter für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte sowie Einsatzverwundete vorgenommen?
Generalarzt Dr. Mattiesen: Lassen Sie mich dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin ja nun der dritte Amtsinhaber auf diesem Dienstposten. Brigadegeneral a. D. Christof Munzlinger hat wesentlich zur Anpassung der gesetzlichen Regelungen beigetragen. So erlauben heute das Einsatzversorgungsgesetz, das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz, das Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz und die Einsatzunfallverordnung viele Maßnahmen, um den erkrankten Soldaten sehr schnell gerecht zu werden. Generalmajor Klaus von Heimendahl hat dann mit viel Empathie und Einsatz Enormes für die einzelnen Soldaten geleistet. Diesen Weg werde ich mit meinem Team weitergehen. Was ich mir dazu noch zusätzlich auf meine Fahnen geschrieben habe, ist die Beschäftigung mit grundsätzlichen wissenschaftlichen Fragestellungen, auch im internationalen Vergleich zur Versorgungssituation in den Ländern alliierter Streitkräfte. Ich habe Besuche in Frankreich, den Niederlanden und in Österreich geplant, um zu erfahren, wie unsere unmittelbaren Nachbarn mit dieser Thematik umgehen. Neben der unbedingten Fortführung der bisherigen Arbeit will ich deshalb auch die internationalen Kontakte ausbauen und wissenschaftliche Erkenntnisse vermehrt heranziehen. Das ist als Weiterentwicklung zu verstehen, nicht als Paradigmenwechsel. Am Ende bleibt mir der Dank an alle, die im Bundesministerium der Verteidigung, im Bereich des Bundesamtes für das Personalmanagement sowie im Sanitätsdienst der Bundeswehr und andernorts Hervorragendes für die uns anvertrauten Soldatinnen und Soldaten leisten. Dies verbinde ich aber auch mit dem Wunsch an uns alle, Kommunikationsbarrieren noch besser als bisher abzubauen und Prozesse zu verschlanken.
WM: Für dieses Gespräch sagen wir Danke. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Kraft und Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben
Generalarzt Dr. Bernd Mattiesen
geb. am 28. Juni 1958 in Tübingen
Verheiratet mit der Nervenärztin Dr. Susanne-Carola Mattiesen; Vater von zwei erwachsenen Söhnen und Großvater von zwei Enkeltöchtern.
Dienstlicher Werdegang:...
- Juni 1978: Abitur in Oberstdorf im Allgäu
- 1978 - 1984: Medizinstudium in Ulm mit Studienstipendium des Freistaates Bayern
- 1984: Approbation und Promotion an der Universität Ulm
- 1984 - 1986: Truppenarzt beim Nachschubbataillon 220, Günzburg
- 1986 - 1989: S3-Sanitätsstabsoffizier beim Korpsarzt II. Korps, Ulm
- 1989 - 1990: Brigadearzt der Panzerbrigade 28, Dornstadt
- 1990 - 1992: Lehrgangsteilnehmer am 33. Generalstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg
- 1992 - 1995: Hörsaalleiter, anschließend Fachlehrer an der Sanitätsakademie der Bundeswehr, München
- 1995 - 1996: Referent im BMVg, Bonn: Personalführung der Ärzte des Heeres
- 1996 - 1999: Referent und Sanitätsstabsoffizier beim Führungszentrum der Bundeswehr im BMVg, Bonn
- 1999 - 2000: Referent im BMVg, Bonn: Angelegenheiten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Verbündeten innerhalb von NATO und EU
- 2000 - 2001: Stellvertreter des Kommandeurs der Sanitätsbrigade 1, Leer/Ostfriesland
- 2001 - 2005: Medical Advisor beim Eurokorps, Straßburg/Frankreich
- 2005 - 2006: Chef des Stabes und Stellvertreter des Kommandeurs Sanitätskommando IV, Bogen
- 2006 - 2010: Referatsleiter im BMVg, Bonn: Grundlagen des Sanitätsdienstes, Konzeption, Einsätze, Planung und internationale Zusammenarbeit
- 2010 - 2012: Referatsleiter im BMVg, Bonn: Zentrale Angelegenheiten des Sanitätsdienstes, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Controlling
- 2012 - 2013: Kommandeur Regionale Sanitätseinrichtungen Sanitätskommando IV, Bogen;
- mit der Führung des Kommandos beauftragt
- 2013 - 2015: Stellvertretender Kommandeur Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, Weißenfels, Beauftragter für Zivil – Militärische Zusammenarbeit im Sanitätsdienst und Inspizient für das Reservistenwesen im Zentralen Sanitätsdiendienst der Bundeswehr
Derzeitige Verwendung:...
seit 01.07.2015: Beauftragter für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte im Bundesministerium der Verteidigung
Auslandseinsätze:...
- 08/2004 - 02/2005: Chief Medical Advisor ISAF, HQ ISAF, Kabul/Afghanistan (Oberstarzt)
- 10/2013 - 06/2014: Chief Medical Advisor ISAF, HQ ISAF, Kabul/Afghanistan (Generalarzt)
Datum: 19.07.2016
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2016/2