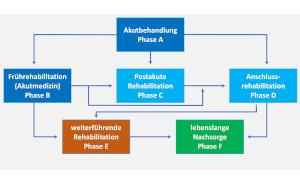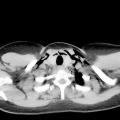Nach einem schweren Arbeitsunfall kam Berufskraftfahrer Roland Knecht in das BG Klinikum Bergmannstrost Halle. Nach langen Monaten der Behandlung und Rehabilitation steht er nun kurz vor der Rückkehr an seinen Arbeitsplatz. Um wirklich vorbereitet zu sein auf seinen körperlich anstrengenden Beruf, trainiert er in einer speziellen Rehamaßnahme ganz gezielt für seine Tätigkeit. Dafür sitzt er regelmäßig auf einem Lkw, der nicht fährt und steht auf einer Baustelle, die nicht vorankommt.
Man könnte Roland Knecht für einen Bauarbeiter halten: In knallorangenem Arbeitsoverall, Helm und Arbeitshandschuhen sieht man ihn täglich auf einer kleinen Baustelle hinter dem Bergmannstrost, wo er Pflastersteine verlegt und an einem Werkzeugschuppen baut. Nicht ins Bild passt der zweite Arbeiter, der scheinbar tatenlos immer nah dabei steht, Roland Knecht genau zusieht und ab und an Hinweise gibt.
Tatsächlich ist Roland Knecht Patient des Bergmannstrost. Gerade absolviert er eine sogenannte Tätigkeitsorientierte Rehabilitation (TOR). Immer an seiner Seite ist ein Arbeitstherapeut. Und die Baustelle ist eine Trainingsbaustelle, um all die körperlichen Belastungen zu trainieren, die Roland Knecht für seinen Beruf braucht. Denn das ist das Ziel: Der 58-jährige will zurück an seinen Arbeitsplatz. Trotz des schweren Unfalls, den er ein halbes Jahr zuvor hatte.
Sturz mit Folgen
Damals hatte Roland Knecht einen kurzen Blackout und stürzte aus etwa zwei Metern Höhe von seinem Lkw. Als er auf dem Steinboden aufkam, hörte er einen „lauten, innerlichen Knall“ in seinem Körper. Mit starken Schmerzen im Becken kam der Berufskraftfahrer in die Notaufnahme des BG Klinikums Bergmannstrost Halle. Noch bevor er umfassend untersucht wurde, merkte er, dass er eigentlich laufen kann – gebückt und langsam, aber das geht schon, fand Roland Knecht. Und beschloss, dass er wieder nach Hause fahren könne. „Die Ärzte wollten mich dabehalten, aber das hielt ich nicht für notwendig.“
Nach drei Tagen musste er einsehen, dass seine Einschätzung wohl falsch war. Sein Chef brachte ihn wieder in die Notaufnahme. MRT, CT und dann die Diagnose: Das Becken ist gebrochen, mehrfach. „Die Ärzte konnten nicht fassen, dass ich halbwegs aufrecht stehen konnte“, erzählt Roland Knecht. Eigentlich müsste er jetzt operiert werden. Oder einen Gips bekommen. Aber OP, Krankenhaus, Gips – das war dem aktiven Roland Knecht nicht recht. Er fragte nach einer anderen Möglichkeit. Und tatsächlich, die gab es: 13 Wochen musste er ein Korsett tragen, bis die Brüche verheilt waren. „Ich konnte nichts machen, habe fast nur gelegen und musste mich auf allen Vieren vorwärtsbewegen. Aber ich konnte zu Hause sein.“ Seine Frau, die in der Pflege arbeitet, kümmerte sich um ihn. Er übersteht dieses Vierteljahr. „Das war eine schwere Zeit.“ Danach schließen sich Physiotherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie im Bergmannstrost an, denn Muskeln müssen wiederaufgebaut, der Körper mobilisiert werden. Auch psychologische Unterstützung bekommt er in der Klinik. „Die Frage, warum ich gestürzt bin, hat mich lange beschäftigt. Und noch immer zucke ich zusammen, wenn ich einen lauten Knall höre.“ Das Geräusch erinnere ihn an diesen inneren Knall bei seinem Sturz.
Trotz allem: Das Ziel von Roland Knecht ist es, wieder in seinem Beruf arbeiten zu können. Er ist Berufskraftfahrer für ein Unternehmen, das Glasfasern verlegt. „Ich fahre Lkw, bin auf den verschiedenen Baustellen mit vor Ort und fasse dort mit an. Das ist abwechslungsreich, flexibel und darum genau mein Ding.“ Aber die körperlichen Einschränkungen nach der schweren Verletzung sind noch zu groß, als dass er wieder direkt in seinen Job hätte einsteigen können.
Pflastern in der Reha
Seine zuständige Berufsgenossenschaft, die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, gewährt ihm darum eine Tätigkeitsorientierte Rehabilitation. In dieser trainieren Patienten wie Roland Knecht die täglichen Handgriffe und körperlichen Herausforderungen ihres Berufes. „Die TOR gibt es nur an berufsgenossenschaftlichen Kliniken wie dem Bergmannstrost, einfach weil der zeitliche und finanzielle Aufwand sehr groß sind“, sagt Dr. Christiane Anke, Oberärztin an der Klinik für Physikalische und Rehabilitative Medizin und für das TOR-Angebot verantwortlich. Die Rehamedizinerin erklärt das Besondere an dem Angebot in Halle: „Unsere Patienten üben nicht an simulierten Arbeitsplätzen in einem Therapieraum. Vielmehr haben wir direkt auf dem Klinikgelände eigene Werkstätten, einen Lkw und eine Baustelle als sogenannte Modellarbeitsplätze aufgebaut. So können die Patienten besonders realitätsnah üben.“ Und so kommt es, dass Roland Knecht am Hintereingang des Bergmannstrost auf einer Baustelle arbeitet, die scheinbar seit Jahren nicht vorankommt. Mit Baugerüsten, Pflasterstein-Flächen und gestapelten Holzbohlen. Roland Knecht übernimmt hier unter anderem Pflasterarbeiten in kniender Position: „Ich habe erstmal mit den kleinen Pflastersteinen angefangen.“ Diese Haltung bereitet ihm nach seinem Beckenbruch noch Probleme und wird unter therapeutischer Anleitung geübt.

Ein Lkw fürs Krankenhaus
Roland Knecht ist außerdem einer der ersten Patienten des Bergmannstrost, die auf dem neuen Trainings-Lkw arbeiten können. „Das ist unsere neueste Errungenschaft“, berichtet Christiane Anke. Der Lkw wurde erst im November 2022 eigens für die Rehabilitation angeschafft. Denn viele Patienten der TOR im Bergmannstrost sind Berufskraftfahrer, die bei der Arbeit verunglückt sind. Häufig, wie Roland Knecht, durch einen Sturz von der Ladefläche. „Nun haben wir optimale Möglichkeiten, mit den Patienten zum Beispiel den Ein- und Ausstieg am Fahrerhaus, das Be- und Entladen, das Bewegen der Plane oder einen Reifenwechsel zu trainieren.“
Individuelle Therapie
Vier Wochen absolviert Roland Knecht die stationäre TOR mit täglich vier bis sechs Stunden Arbeit und begleitender arbeitsplatzspezifischer Physio-, Sport- oder Ergotherapie. Start ist meist um 7:30 Uhr, die späteste Einheit dauert bis 16:30 Uhr. Wann was anliegt, gibt der straff getaktete Therapieplan vor. Der basiert auf der ärztlichen Anordnung der Oberärztin Dr. Anke und wird in enger Abstimmung mit den Therapeuten erstellt. Dafür kennen Ärztin und Therapeuten den Patienten, seine Krankengeschichte, den Behandlungsverlauf, seine körperlichen Einschränkungen und den beruflichen Hintergrund ganz genau. „Während der Rehabilitation steht der Therapieplan immer auf dem Prüfstand. Die Therapeuten liefern uns Rehamedizinern klar dokumentierte Ergebnisse und Daten: Wo liegen die Belastungsgrenzen des Patienten, wie sind die Fortschritte, treten körperliche Probleme auf? In einer wöchentlichen interdisziplinären Visite entscheiden wir Mediziner gemeinsam mit den Therapeuten, ob die Behandlung angepasst oder fortgesetzt wird. Auch mit den behandelnden Chirurgen aus dem Haus können wir jederzeit Kontakt aufnehmen, um Rücksprache bei medizinischen Fragestellungen zu halten.“ So entsteht ein individueller Therapieplan, der ganz auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnitten ist.
Vom Techniker zum Therapeuten
Was genau der Patient im arbeitstherapeutischen Training macht, liegt in der Hand der vier Arbeitstherapeuten des Bergmannstrost. Marcus Günther ist einer von ihnen. Er erklärt, warum die TOR des Bergmannstrost auch personell etwas Besonderes ist: „Normalerweise übernehmen Ergotherapeuten mit einer Zusatzausbildung die berufliche Rehabilitation. Auch wir haben eine entsprechende Weiterbildung absolviert, sind aber alles ausgebildete Techniker und Handwerker. Das heißt, wir haben mal die gleiche Arbeit gemacht wie unsere Patienten. Wir wissen genau, worauf es ankommt und sprechen die gleiche Sprache.“ Marcus Günther ist selbst gelernter Anlagenmechaniker und wurde 2011 in der Technikabteilung des Bergmannstrost angestellt. Damals kamen immer mal wieder die Rehamediziner mit Patienten vorbei, die vor ihrer Wiedereingliederung ihre Arbeitshandgriffe üben sollten – der Beginn der beruflichen Rehabilitation im Bergmannstrost. Inzwischen haben Marcus Günther und seine drei Kollegen alle eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung absolviert und betreuen parallel bis zu zwölf PatientInnen.
Kreative Modellarbeitsplätze
Für seine jetzige Arbeit brauchen er und seine Kollegen vor allem eines: Kreativität. „Fragt man fünf Schlosser, machen die fünf verschiedene Tätigkeiten. Darum machen wir vor dem Start der Maßnahme eine Tätigkeitsanamnese und erfragen, was der Patient an seinem Arbeitsplatz genau tut. Erst dann planen wir, wie wir diese Tätigkeit möglichst realistisch hier vor Ort üben können. Immer im Blick haben wir die körperlichen Defizite und Belastungsgrenzen des Patienten.“ Im Laufe der Jahre hat das TOR-Team des Bergmannstrost Modellarbeitsplätze für zahlreiche berufliche Tätigkeiten eingerichtet. Ob für Tischler, Schlosser, Heizungsinstallateure oder Elektriker – die Therapie-Werkstatt bietet ein ausgeklügeltes Nebeneinander von Rohrsystemen, Schaltkästen, Werkbänken, einem Motorblock oder Belüftungsanlagen. Alles selbst konzipiert und gebaut von den Arbeitstherapeuten.
„Wir können nicht den Schrank aufmachen und für einen Patienten das passende Tool rausholen. Im Grunde erzählt uns der Patient, was er braucht. Und wir entwickeln das passende Angebot“, so Marcus Günther. An die 60 Berufe sind es mindestens, die inzwischen abgebildet werden können. Auch Köchin, Tierpfleger und Schornsteinfeger gehören mit dazu.

Was war sein ungewöhnlichster Fall? „Das war ein Bestatter, der das Tragen von Lasten trainieren musste. Wir haben eine Trage aus der Notaufnahme geholt und Zementsäcke daraufgelegt. Die habe ich dann gemeinsam mit dem Patienten durch ein wenig genutztes Treppenhaus getragen.“ Damals lief ihnen prompt der damalige Verwaltungsdirektor über den Weg – der irritiert fragte, warum sie für den Transport nicht einfach den Aufzug nutzen würden. „Ich glaube, die Kollegen im Haus wundern sich so manches mal, was wir da eigentlich machen!“ Dabei müssen die Arbeitstherapeuten nicht nur die Trainingsmodule im Blick haben. „Wir müssen die körperlichen Grenzen der Patienten erkennen und dürfen sie trotzdem nicht demotivieren“, so Marcus Günther. Denn sieht der Patient nur, was noch nicht geht, kann das ein deprimierender Prozess sein. „Immerhin hängt meist die Existenz an dem Beruf“, so Günther. Auch deshalb begleiten Psychologen aus der Abteilung Medizinische Psychologie die Rehabilitation.
Am Ende der Maßnahme steht nahezu immer die erfolgreiche Rückkehr in den Beruf. Das ist auch der Plan von Berufskraftfahrer Roland Knecht. Er will direkt nach der TOR seine bisherige Arbeit wieder aufnehmen. Auch sein Chef wartet bereits auf ihn und hat ihn schonmal mit einer neuen Arbeitsmontur ausgestattet. Die körperlichen Folgen des Unfalls hat Roland Knecht inzwischen gut im Griff: „Ich bin froh, dass ich alles so gut überstanden habe.“ Seinen Therapeuten, die ihn die letzten Wochen und Monate begleitet haben, ist er dafür dankbar: „Das sind Top-Leute!“
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2024
Dr. A.-K. Hartinger
BG Klinikum Bergmannstrost Halle
Merseburger Str. 165
06112 Halle
E-Mail: [email protected]