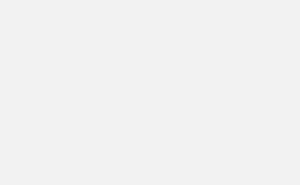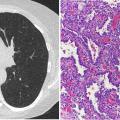PHYSIOLOGISCHE, TESTPSYCHOLOGISCHE UND EPIGENETISCHE PARAMETER VON SOLDATEN
Eine aktuelle Studie zur Inzidenz und Prävalenz von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) („Dunkelzifferstudie 2013“) zeigt, dass bei Soldaten nach einem Auslandseinsatz die 12-Monatsprävalenz der PTBS 1,8 - 2,9 % beträgt (Wittchen, 2012).
Bei Soldaten, die einem traumatischen Ereignis ausgesetzt waren, beträgt die 12-Monatsprävalenz sogar 5,9 - 6,1 %. Insgesamt haben Soldaten mit Auslandseinsatz ein 2-4fach erhöhtes Risiko an einer PTBS zu erkranken, gegenüber Soldaten ohne Auslandseinsatz. Auch die Inzidenz (Neuerkrankungsrate) von anderen psychischen Erkrankung steigt durch einen Auslandseinsatz an (Kontrollgruppe vs. Längsschnitt nach dem Einsatz: 1,5 % vs. 6,7 %)(Angststörungen 3,6 %, Affektive Erkrankungen 1,8 %, Alkoholstörungen 1,5 %). Vor diesem Hintergrund ist es ein zentrales Anliegen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, mögliche objektive Prädiktoren einsatzbezogener psychischer Erkrankungen sowie biologische Marker zur Verlaufskontrolle von Therapieeffekten zu identifizieren.
In Kooperation mit zivilen Forschungseinrichtungen (TU Dresden, Universität Leipzig, Charité Berlin, LMU München, Medizinische Hochschule Hannover) wird unter Federführung des Psychotraumazentrums (PTZ) am Bundeswehrkrankenhaus Berlin seit 2012 eine Studie zur Identifizierung von Parametern durchgeführt, die eine verbesserte Aussage für die Entwicklung von einsatzbedingten psychischen Störungen ermöglichen. Entsprechend dem Auftrag des PTZ wurden im Rahmen der Studienplanung Experten aus zivilen Einrichtungen identifiziert, da es bei der thematischen Breite der Untersuchung nicht effizient gewesen wäre, eigene Expertise aufzubauen. Weiterhin wird hierdurch zum einen eine enge Verzahnung zwischen militärischer und ziviler Forschung erreicht, welche einerseits für folgende Forschungsvorhaben genutzt wird, zum anderen eine bessere Vergleichbarkeit von zivilen und militärischen Gruppen erreicht. Eine weitere Besonderheit dieser Studie ist, dass aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Parametern erstmalig in diesem Ausmaß Aussagen über Beziehungen zwischen den einzelnen Parametern getroffen werden können.
Da zu dieser Fragestellung, auch im zivilen Bereich, bisher wenige eindeutige und aussagekräftige Daten vorliegen, handelt es sich bei diesem Forschungsvorhaben um ein Projekt, welches Ansätze für weitere Arbeiten liefern soll. Diese sollen dann möglicherweise zu einer verbesserten Risikoeinschätzung für Soldaten (vor einer Erkrankung) und damit einhergehend besseren, weil individualisiert, Nachsorge und Behandlung führen.
Die Rekrutierung der Probanden erfolgt über die Abteilung VIb des Bundeswehrkrankenhauses Berlin (Station, Ambulanz und Psychotraumazentrum). Nach Herstellung eines Informed Consent erfolgt der Studieneinschluss sowie nach eingehender Untersuchung die Zuteilung in die Versuchsgruppen [Tab.1]. Das Studiendesign sieht dabei je nach Versuchsgruppe bis zu drei Meßzeitpunkte vor.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die einzelnen untersuchten Parameter und deren Hintergründe gegeben.
Haar-Cortisol (Kooperationspartner: Prof. Dr. Kirschbaum, Biopsychologie der TU Dresden)
Veränderungen der Cortisolspiegel nach traumatischem Erleben konnten in zahlreichen Studien nachgewiesen werden. Die meisten Studien zeigten einen Hypocortisolismus bei der PTBS (Yehuda et al. 1990 und 2000; Olff et al. 2006). Olff et al. (2007) konnten bei Therapie-Respondern eine Erhöhung der Plasmacortisolwerte, dagegen bei Therapie-Nonrespondern eine Reduktion der Cortisolspiegel ermitteln. Die Methode der Haarsegmentanalyse ermöglicht eine retrospektive Erfassung kumulativer Cortisollevel über einen Zeitraum der vergangenen sechs Monate und stellt damit einen wesentlichen Beitrag für die Erforschung chronischer, stressassoziierter Erkrankungen dar (Gow et al. 2010). Zudem konnte gezeigt werden, dass Haarcortisolkonzentrationen stressbedingte Veränderungen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse widerspiegeln können (Kalra et al. 2007; van Uum et al. 2008; Dettenborn et al. 2010). In einer aktuellen Studie zur Untersuchung des Haarcortisols als Biomarker bei Patienten mit einer PTBS zeigte sich im Vergleich zu einer nicht traumatisierten Kontrollgruppe bei 59 % der Patienten eine niedrigere Haarcortisolkonzentration. Dabei zeigte sich ein negativer Zusammenhang mit der Häufigkeit der Intrusionen, der Frequenz der Traumatisierungen, der Anzahl der verschiedenen lebenszeitlichen traumatischen Erfahrungen sowie der Zeit seit der letzten Traumatisierung (Steudte et al. 2013).
Zytokine (Kooperationspartner: Prof. Dr. H. Himmerich, Universität Leipzig)
In präklinischen Studien wurde gezeigt, dass Stress im Tierversuch zur Hochregulation von Zytokinen (Botenstoffen des Immunsystems) wie Interleukin (IL)-6, Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-α und IL-1β in für die PTBS-Entstehung wichtigen Gehirnregionen führt, z. B. in der Amygdala, dem Hippocampus und dem Hypothalamus (Koo und Duman 2008; Deak et al. 2005; Zhou et al. 1993). In den letzten Jahrzehnten wurde zunehmend klar, dass diese Zytokine eine wichtige Rolle in der Steuerung der Gedächtnisfunktion sowie in der Entstehung von Ängstlichkeit und Furcht haben (French et al. 1999; Schöbitz et al. 1993; Wong und Licinio 1994). In klinischen Studien wurde gezeigt, dass Menschen, die physischem oder psychischem Stress ausgesetzt waren, zum Teil noch mehrere Monate nach dem Trauma Erhöhungen in der Plasmakonzentration verschiedener Zytokine haben (Maes et al. 1999; Baker et al. 2001; Gill et al. 2008; Spivak et al. 1997; von Känel et al. 2007), die nicht durch Auffälligkeiten in der HPA-Achse erklärt werden konnten (Apfel et al. 2011). Nicht nur im Plasma, sondern auch im Liquor von PTBS-Patienten konnte eine Erhöhung der Zytokinproduktion nachgewiesen werden (Baker et al. 2001). Zytokine scheinen auch das Volumen von Gehirnstrukturen zu verändern (Golub et al. 2011; Hein et al. 2012). Als weitere Möglichkeiten, wie Zytokine zu psychischen Erkrankungen führen, die möglicherweise auch für die Entstehung der PTBS relevant sein könnten, kommen eine Aktivierung der HPA-Achse, eine Aktivierung von Serotonintransportern, eine Stimulation der Indolamin-2,3-Dioxygenase, die zur Tryptophandepletion führt, ein immunologisch vermittelter Neuronenuntergang oder neurotoxische Effekte in Betracht (Himmerich et al. 2011).
Oxytocin (Kooperationspartner: Prof. Dr. Hellweg, Charité Campus Mitte)
Oxytocin ist ein Neuropeptid, welches im Hypothalamus gebildet und über die Neurohypophyse ausgeschüttet wird. Es scheint, neben seiner Funktion während des Geburtsprozesses, für die Bindung („attachment“) des Kindes, das mütterliche „Bonding“ und die Beziehung zwischen den Partnern eine Rolle zu spielen (Marazziti und Catena Dell'osso 2008; Bartz und Hollander 2006). Darüber hinaus spielt es wohl auch eine Rolle in vielen anderen sozialen Beziehungen. Die Vasopressin-Oxytocin-Antwort wird als Augmentation der Stressantwort aufgefasst (Teicher et al. 2002). Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Prävalenz der PTBS werden unter anderem mit niedrigeren Oxytocin-Konzentrationen begründet (Olff et al. 2007a). In experimentellen Studien konnte kürzlich nachgewiesen werden, dass Oxytocin Wirkungen auf die Angstverarbeitung hat. Oxytocin scheint eine verminderte Amygdala-Aktivierung und eine verminderte Ängstlichkeit zu induzieren (Olff et al. 2010). Es wird dabei postuliert, dass die soziale Interaktion durch Aktivierung entsprechenden Hirnarealen durch Oxytocin beeinflusst werden kann. Im Tierexperiment konnte nachgewiesen werden, dass die Gabe von Oxytocin signifikant die Corticosteroid-Antwort bei Stresssituation über die geringere Expression von Glukokortikoid-Rezeptoren und erhöhter Mineralokortikoid¬-Rezeptor-Expression moduliert (Cohen et al. 2010).
HS-Omega3-Index (Kooperationspartner: Prof. Dr. Schacky auf Schönfeld, LMU München)
Der HS-Omega-3 Index repräsentiert die zelluläre Konzentration an den Omega-3 Fettsäuren Eicosapentaen (EPA)- und Docosahexaensäure (DHA) (von Schacky, 2010). EPA und DHA haben wichtige strukturelle und funktionelle Rollen im menschlichen Gehirn. Sie erhöhen die serotonerge Neurotransmission, erhöhen die dendritische Arborisation und Synapsenbildung, verhindern Apoptose von Neuronen, und modulieren lonenkanäle (Freeman et al. 2006). Die Ergebnisse von Interventionsstudien mit EPA und DHA bei psychiatrischen Erkrankungen waren vielversprechend, aber nicht eindeutig (Freeman et al. 2006; Carney et al. 2010). Inzwischen hat sich ein erniedrigter HS-Omega-3-Index u.a. als möglicher Risikofaktor für psychische Erkrankungen wie die Major Depression herausgestellt (Baghai et al. 2011; McNamara et al. 2010; Lin et al. 2010). Sollte sich zeigen, dass der HS-Omega-3 Index bei PTBS niedriger liegt, als bei Kontrollgruppen, so würde es sich anbieten, über Interventionsstudien mit diesen Omega-3 Fettsäuren nachzudenken (zunächst zur sekundären, dann zur primären Prävention des PTBS), wie es in Japan und USA bereits getan wird (Matsuoka et al. 2010).
NGF und BDNF im Serum / Genotypisierung (Kooperationspartner: Prof. Dr. Hellweg, Charité Campus Mitte)
Der pathophysiologische Einfluss von neurotrophen Proteinen bei der PTBS ist weiterhin ungeklärt. Insbesondere der Nerve-Growth-Factor (NGF) sowie Brain-Derived-Neurotrophic-Factor (BDNF) regulieren die neuronale Plastizität und damit die Neurotransmission sympathischer und sensorischer Neurone. Daneben zeigen sich Hinweise, dass NGF und BDNF stressassoziierte und neuroimmunomodulatorische Wirkungen haben. Pilotstudien weisen auf eine chronische NGF-Erhöhung als Ausdruck einer ungedämpften Stressreaktion hin (Lang et al. 2009b). In Metaanalysen zeigten sich im Vergleich zu gesunden Kontrollgruppen niedrigere BDNF Serumkonzentrationen bei depressiven Patienten (Sen et al. 2008). Antidepressiva, die z. B. auch bei PTBS als "first-line"-Medikation eingesetzt werden, haben Effekte auf die BDNF-Serumkonzentrationen, was sich z. B. durch eine deutliche Erhöhung der BDNF Serumkonzentration nach antidepressiver Therapie zeigt (Huang et al. 2008), (Piccinni et al. 2008), (Yoshimura et al. 2007), (Aydemir et al. 2006), (Gonul et al. 2005), (Aydemir et al. 2007). Bei einer kleinen Stichprobe von 34 akut traumatisierten und PTBS-erkrankten Patienten wurden höhere BDNF-Serum¬konzentrationen in der Gruppe der Akuttraumatisierten im Vergleich zu Kontrollgruppe nachgewiesen (Hauck et al. 2010). Wiederum scheinen im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe niedrigere BDNF Serumkonzentrationen bei PTBS-Patienten vorzuliegen (Dell'Osso et al. 2009). Im Tierexperiment ergaben sich Anzeichen, dass Übungen zum Stressabbau die BDNF Konzentration im Striatum erhöhen. Diese BDNF Erhöhungen korrelieren mit dem Abfall des depressiv-artigen Verhaltens der Tiere. Somit könnte dies im Zusammenhang mit der Erhöhung der neuronalen Plastizität beschrieben werden (Marais et al. 2009). Neueste Studien zeigen bei der therapeutischen Applikation von BDNF eine „Angstauslöschung" im Tierexperiment (Peters et al. 2010). Daher kann als Hypothese angenommen werden, dass ein niedriger BDNF-Gehalt im Serum mit einem höheren Risiko korreliert, an einer PTBS bei potenziell traumatisierendem Einwirken zu erkranken.
Epigenetik (Methylierung der DNA im Promotorbereich der Kandidatengene BDNF, NGF und Oxytocinrezeptor)(Kooperationspartner: Prof. Dr. Frieling, Medizinische Hochschule Hannover)
Erst in den letzten Jahren gewinnt die Erforschung so genannter epigenetischer Prozesse auch für psychische Störungen und die Steuerung von Verhaltensweisen an Bedeutung, obwohl diese Mechanismen bereits seit langem vor allem im Bereich der Onkologie erforscht werden. Durch Methylierung der DNA und durch Modifikationen an den Histonproteinen, die die Chromatinstruktur beeinflussen, können Gene reguliert werden. Die Bedeutung dieser epigenetischen Prozesse wurde für zahlreiche Erkrankungen, wie Tumorleiden, Entwicklungsstörungen und neurologische Syndrome nachgewiesen. Sie sind jedoch auch wichtig für die Kontrolle normaler Entwicklungsprozesse (Rodenhiser und Mann, 2006). Durch epigenetische Veränderungen können frühere Gen-Umweltinteraktionen gespeichert werden, so dass eine Form von molekularem Gedächtnis entsteht. Die Bedeutung dieser Prozesse für die Translation früher traumatischer Erfahrungen in spätere psychobiologische Dysfunktion unterstreicht eine Reihe tierexperimenteller Befunde. Veränderungen der genspezifischen DNA-Methylierungsmuster konnten inzwischen bei verschiedenen psychischen Störungen wie Abhängigkeit (Bleich et al. 2006), Essstörungen (Frieling et al. 2007) und Schizophrenie (Abdolmaleky et al. 2005) nachgewiesen werden. Erste spezifische Befunde zu PTBS und epigenetischen Veränderungen bei Menschen liegen vor: eine aktuelle Studie, bei der DNA-¬Methylierungsprofile im peripheren Blut von Menschen nach schwerwiegenden Ereignissen untersucht wurde, zeigte eindeutige Unterschiede in der Methylierung zahlreicher Gene zwischen denjenigen Probanden, die eine PTBS entwickelt hatten und denen, die keine Traumafolgestörung hatten (Uddin et al. 2010).
Herzfrequenzvariabilität (HRV)(Psychotraumazentrum der Bundeswehr)
Die Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) wurde in Studien (u.a. Wagner et al., 1998; Fogt et al., 2009) der letzten Jahre vermehrt untersucht, um den Umfang einer Beanspruchung des Menschen zu beschreiben. Die HRV kennzeichnet die Schwankungen der Herzschlagfrequenz innerhalb eines definierten Zeitraumes und gilt als Parameter der neurovegetativen Balance des autonomen Nervensystems. Die Beurteilung der HRV hinsichtlich möglicher Veränderungen oder Abweichungen von Normwerten (Wagner et al., 1998) erfolgt durch Messung der Abstände aufeinanderfolgender NN-Intervalle (Abstand zwischen zwei R-Zacken im EKG) und deren Interpretation bezüglich Zeit- und Frequenzvarianzen. Zusammenhänge zwischen der HRV als Parameter der Anpassungsfähigkeit an innere und äußere Beanspruchungsfaktoren und individueller Stressbewältigung konnten u.a. Schmidt et al. (2008) und Böckelmann et al. (2006) zeigen.
Funktionelle Magnetresonanztomographie (Kooperationspartner: Prof Dr. Gallinat, Charité / St. Hedwigs Krankenhaus)
In der zugänglichen Literatur finden sich für Soldaten mit Einsatzfolgestörungen bislang keine Studien, die sich mit der funktionellen Bildgebung befassen, obwohl sich die Durchführung von funktionellen Magnetresonanztomographie-Studien bei psychiatrischen Krankheiten seit mehreren Jahren in der wissenschaftlichen Anwendung etabliert hat. Es konnten mithilfe der funktionellen Bildgebung Unterschiede der normalen und traumatypischen Informationsverarbeitung und Gedächtnisbildung festgestellt werden. Dabei stehen in der Verarbeitung des sensorischen Inputs die Thalamusregion sowie das limbische System mit den benachbarten Regionen von Hippocampus und Amygdala im Mittelpunkt.
Die Neuromodulation der Hirnaktivität beeinflusst durch Stresshormone (Noradrenalin) die Qualität des Abspeicherungsprozesses von Erinnerungen und scheint somit verantwortlich für Qualität von Gedächtnisfunktionen. Bei der deklarativen Gedächtnisbildung kommt es i. S. einer sogenannten funktionellen Diskonnektion zwischen den primären informationsverarbeitenden Zentren zu einer Fragmentierung traumatischer Erinnerungen. Daneben wurden neurotoxische Effekte von Cortisol auf hippocampale Zentren diskutiert, die zu einer Zelldegeneration führen sollen (Gurvits et al. 1996). Zusammenfassend belegen Studien inzwischen die Beteiligung von Hirnarealen wie dem präfrontalen Cortex, Cingulum, Thalamus, Insula, Amygdala, Hippocampus und Broca-Region (Jatzko et al. 2006). In Metaanalysen wurden Aktivitätserhöhungen von Amygdala, Insula sowie eine Hypoaktivierung im rostralen und dorsalen anterioren Cingulum wie auch im ventromedialen präfrontalen Cortex festgestellt, was mit der Emotionsregulation in Verbindung gebracht werden konnte (Etkin und Wager 2007).
Erfassung der testpsychologischen Parameter (Psychotraumazentrum)
Ziel dieser Untersuchungen ist es eine Korrelation zwischen physiologischen Faktoren und dem klinischen Befinden sowie dem Ansprechen auf die Therapie herzustellen. Neben den physiologischen sind daher die psychologischen Faktoren der Hauptschwerpunkt der Untersuchungen. Im Weiteren werden die einzelnen Messinstrumente allerdings nur kurz skizziert.
Derzeit werden im Rahmen der Studie die letzten Probanden eingeschlossen, so dass nach Durchführung der Verlaufsuntersuchungen gegen Ende des Jahres mit dem Versand und der Auswertung der über einen Zeitraum von vier Jahren gesammelten Proben und Daten begonnen werden kann. Nach der dann folgenden wissenschaftlichen Auswertung, der Planung von anschließenden Studien und der Ableitung von möglichen Veränderungen in Diagnostik, Prävention und Therapie von einsatzbedingten Erkrankungen geht mit dieser Studie eines der ersten und sicher auch bisher umfangreichsten Projekte des Psychotraumazentrums der Bundeswehr seinem Abschluss entgegen.
In den vergangenen Jahren ist es dem, in der Forschungslandschaft noch jungen, Psychotraumazentrum gelungen, durch dieses und andere Projekte, sich hervorragend mit dem zivilen Forschungsbereich zu vernetzen, klinische Studien mit hohen wissenschaftlichen Standards durchzuführen und insbesondere für unsere Soldaten/Soldatinnen Erkenntnisse für eine bessere Versorgung im Bereich der einsatzbedingten Erkrankungen zu gewinnen. Besonders möchten wir an dieser Stelle den vielen Probanden danken, deren zeitliches und persönliches Engagement diese Studie erst möglich machte.
Datum: 28.11.2014
Quelle:
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2014/3
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2014/3