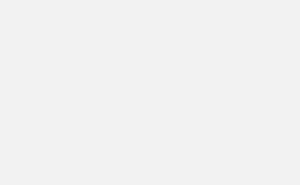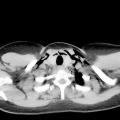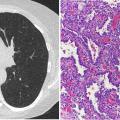Der Weg zum Einsatzversorgungs- und Einsatzweiterverwendungsgesetz
Als ich 1993 das erste Mal in den Einsatz ging, damals nach Somalia, stand das Thema Einsatzschädigung oder die Notwendigkeit, sich um Einsatzgeschädigte zu kümmern, überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Von dem Begriff „PTBS“ hatte man noch nie etwas gehört, selbst als Arzt nicht. Auch dass Soldaten im Einsatz zu Schaden kommen können, war ziemlich abstrakt. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis sich immer mehr mit der Thematik auseinandersetzen. Trotzdem waren 1999 unter den einsatzerfahrenen Soldaten Stimmen zu hören, die – als ein Kamerad mit seinem Panzer von einer Brücke fiel und dabei zu Tode kam – argumentierten, dass dies ja auch in Deutschland hätte passieren können und es eben Schicksal wäre.
Das hat uns damals sehr getroffen! Anfang der 2000er Jahre begann ein Entwicklungsprozess, bei der Fragen nach notwendigem Versorgungsschutz von SoldatInnen die in den Einsatz gehen und der Schaffung von Grundlagen, um dem Fürsorgeanspruch gerecht zu werden, im Vordergrund standen. In den folgenden Jahren verdeutlichten verschiedene Ereignisse, beispielsweise der Hubschrauberabsturz in Afghanistan 2002 und der Busanschlag von Kabul 2003, die dringliche Notwendigkeit. 2004 wurde ein Einsatzversorgungsgesetz erarbeitet und durch den Bundestag gebilligt. Somit waren erstmalig umfangreiche Maßnahmen der Fürsorge für Einsatzsoldaten und vor allem im Einsatz zu Schaden kommende Soldaten vorgesehen.
In der Praxis zeigte sich recht schnell, dass diese Errungenschaften nicht ausreichen. Es stellte sich die Frage, wie mit KameradInnen umzugehen ist, die im Einsatz eine Schädigung erleiden und diese langfristig anhält. Resultat war das 2007 verabschiedete Einsatzweiterverwendungsgesetz, mit dem man sich erstmalig zu der Idee bekannte, Einsatzgeschädigte in den Streitkräften zu halten, ihnen dort eine Heimat zu geben und zu versuchen, sie wieder zu rehabilitieren. Das dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick auf die verschiedenen weltweiten Konzepte zur Umsetzung der Fürsorge durch den Dienstherrn. Es gibt Länder, in denen SoldatInnen, die im Einsatz zu Schaden kommen aber deren Einsatzbereitschaft kurzfristig nicht wiederherstellbar ist, eine hohe Abfindung ausbezahlt wird und die Betroffenen anschließend aus den Streitkräften entlassen werden. Alternativ werden Geschädigte auch frühberentet, ihnen steht eine dauerhafte Versorgung zu, sie sind alimentiert und das Thema ist – ein wenig nach dem Prinzip: „Aus den Augen, aus dem Sinn“ – erledigt.

Der Beauftragte PTBS
Diesen Weg wollte die Bundeswehr nicht gehen. Auf militärischer und politischer Ebene wurde die Verantwortung gegenüber den Soldaten festgestellt und das klare Ziel formuliert, Betroffene in die Streitkräfte zu integrieren und ein Konzept der Fürsorge zu erstellen, das dauerhaft die medizinische und soziale Versorgung dieser Soldaten sicherstellt. 2010 wurde das Büro das Beauftragten PTBS, also für einsatzbedingte posttraumatische Störungen bzw. Einsatztraumatisierte geschaffen. Das Ziel dieses Büros war es, eine Ansprechstelle für Betroffene abzubilden, die damit endlich eine Anlaufstelle hatten, an die sie sich mit Fragen zu Fürsorgeleistungen und zur Fürsorgeverantwortung des Dienstherren wenden konnten. Der Beauftragte PTBS hat gleichzeitig die Aufgabe, die Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung in allen mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) einhergehenden Belangen zu beraten und zu informieren. Zusätzlich ist er beauftragte, Verfahren und Methoden zu entwickeln, um die Fürsorge und die Versorgung der Soldaten unter medizinischem als auch sozialem Blickwinkel weiterzuentwickeln.
Seither haben sich viele Soldaten an uns gewandt und haben aufgezeigt und geschildert, wie es Ihnen geht. Und so können wir heute, wenn wir über Einsatztraumatisierte sprechen, durchaus sagen, dass wir wissen, worum es geht. Voraussetzungen für diese besondere Form der Fürsorge ist die Feststellung des Zusammenhangs zwischen dem Einsatz und der Schädigung. Auch dieses Procedere wurde eine Zeit lang intensiv diskutiert. Noch vor zehn Jahren war es so, dass eine einmalige, sehr schwere Traumatisierung erfolgt sein musste, damit überhaupt eine PTBS anerkannt werden konnte. Heute wird dies durchaus differenzierter betrachtet, beispielsweise können auch mehrere kleinere Traumata in einer psychischen Langzeiterkrankung münden. Vor diesem Hintergrund begannen Überlegungen, wie letztlich Fürsorge und die Versorgung der Einsatztraumatisierten umgesetzte werden können. Schnell wurden dabei zwei große Komplexe identifiziert: Zeit sowie Ruhe und Sicherheit.
Zeit und Sicherheit
PTBS oder psychische Folgeerkrankungen treten zum Teil oft erst Jahre nach dem eigentlichen Einsatz auf. Das hängt auch damit zusammen, dass sie am Anfang noch relativ gut kompensiert werden können. Viele an PTBS Erkrankte schildern, dass sie nach dem Einsatz zunächst überhaupt nicht bemerkt hätten, dass sie eine Traumatisierung erlitten hatten. Sie meisterten einigermaßen ihr Alltagsleben, waren gut kompensiert und stießen auch dienstlich auf keine Probleme. Erst im Laufe der Jahre kam es zu ausgeprägteren Symptomen und zu größeren Schwierigkeiten, mit dem eigenen Leben zurechtzukommen. Eine Folge davon ist leider, dass bei vielen Betroffenen einer Chronifizierung dieser Erkrankung erfolgt ist, was wiederum bedeutet, dass die Therapie langwieriger und komplexer wird. Deswegen brauchen wir Zeit, wenn wir uns um Einsatztraumatisierte kümmern.
Darüber hinaus brauchen Erkrankte Rahmenbedingungen, die ihnen Ruhe und Sicherheit geben, damit sie sich auf die eigenen Aufgaben konzentrieren können: gesund zu werden und in das Leben zurückzufinden. Am einfachsten lässt sich das in den eigenen Reihen organisieren, denn Arbeitsbedingungen können selbst definiert und der Umgang mit KameradInnen festgelegt werden. Daher hielt man noch aktive Soldaten im Soldatenstatus, hat sie nicht entlassen bzw. bei Bedarf wieder in die Streitkräfte eingestellt, um ihnen die notwendige Versorgung zukommen zu lassen. Betroffene werden in der Regel auf sogenannten „Dienstpostenähnlichen Konstrukten“ eingesetzt, um ihnen die nötigen Freiräume zu geben, die wesentlichen Schritte der Gesundung und der Rehabilitation zu durchlaufen.
Zunächst liegt der Fokus immer auf der medizinischen Behandlung, später auf der beruflichen Integration. Derzeit leiden ungefähr 3,5 % unserer SoldatInnen an einer psychischen Erkrankung, die sich als Langzeitfolgen nach dem Einsatz manifestiert hat. Das heißt also, mehr als 2 000 betroffene SoldatInnen müssen einen Weg in ihre eigene Zukunft zurückfinden. Diese KameradInnen befinden sich mit Masse im Dienst und dort entstehen immer wieder Problem.
Herausforderungen im dienstlichen Alltag
Fangen wir an und betrachten das Ganze aus drei verschiedenen Sichtweisen, zunächst aus Sicht des Soldaten. Gehen junge Menschen zur Bundeswehr, werden sie von Anfang an darauf geprägt, Höchstleistung zu zeigen. Es wird von einem erwartet, Belastungen auszuhalten, hart, durchsetzungsfähig und fokussiert zu sein – kurz: hochprofessionell. Kommen diese Personen aus einem Einsatz zurück und stellen bei sich selbst Veränderungen fest, womit sie diesen eigenen Vorstellungen nicht mehr entsprechen können, stellt das einen persönlichen Wertverlust dar. Die meisten SoldatInnen betrachten sich anschließend als weniger wertvoll und haben Problem damit es zuzugeben.
Hinzu kommt, und jetzt sind wir beim zweiten Aspekt, dass natürlich auch das Umfeld, und gerade das dienstliche, eine Rolle spielt. Wenn sich die eigene Vorstellung zum Bild eines Soldaten im entsprechenden dienstlichen Umfeld widerspiegelt, stellt das ein großes Problem dar. Einsatzkräfte definieren heutzutage ihrer Leistungsfähigkeit an der Einsatzbereitschaft – „Sind wir fähig, unseren Auftrag bei Einsätzen zu erfüllen oder sind wir es nicht?“ Darauf liegt der Fokus, denn nur mit einsatzfähigen Kräften können wir auch unseren Auftrag, vor allem bei Auslandseinsätzen, erfüllen. Die große Herausforderung ist, diesen Anspruch mit dem Schicksal Betroffener und dem Umgang mit Einsatztraumatisierten in Einklang zu bringen. Man kann davon ausgehen, dass jeder in der Bundeswehr schon einmal etwas von PTBS gehört hat und weiß, dass es nach Einsätzen zu psychischen Schäden kommen kann.
Es gibt also ein grundsätzliches Verständnis für diese Tatsache. Gleichwohl ist es ganz anders, wenn man solche KameradInnen in seinem Umfeld hat. Nahezu alle sind bemüht, die Erkrankten aufzufangen und zu integrieren. Dem gegenüber stehen Zeitmangel, eine zum Teil enorme Auftragsdichte und selbstverständlich die Einsatzbereitschaft. Nicht alle KameradInnen, mit denen tagtäglich zusammengearbeitet wird, können aber in den Einsatz gehen, sie sind anders, sie sind divers. Hinzu kommt, dass bei psychisch Einsatzgeschädigten oft nicht erkennbar ist, wie schlimm sie erkrankt sind. Häufig sind Betroffene äußerlich völlig normal und lassen keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Gesundheitszustand zu. Dies führt oft zu Zweifeln: „Geht es dem wirklich so schlecht?“, „Könnte der nicht viel mehr machen?“ Vielen fällt es schwer, sich in die Lage der Einsatzgeschädigten hinein zu versetzen. Auch bei Vorgesetzten, die auf die Herausforderung der Fürsorgeaspekte und dem Umgang mit Einsatztraumatisierten und Einsatzgeschädigten vorbereitet werden, kommt es durch Konfrontationen mit der Realität immer wieder zu Konflikten. Die Aufträge sind mannigfaltig: Neben Vorbereitungen auf mögliche Auslandseinsätze stehen parallel vielleicht noch eine Überprüfung nach § 78 der Bundeshaushaltsordnung, Ausbildungen und Übungen an. Auf der anderen Seite haben Vorgesetzte einsatzgeschädigte KameradInnen unter ihrem Kommando, die besondere, zeitintensive Aufmerksamkeit benötigen, was möglicherweise zu einer Unruhe im Verband führt. Problematisch kann es werden, wenn nicht ein, sondern mehrere Einsatztraumatisierte vor Ort sind. Bei einer Zahl von 2 000 Betroffenen findet sich diese Situation nahezu in jede Einheit der Bundeswehr und alle müssen sich damit auseinandersetzen. Was kann man tun, um mit dieser Herausforderung besser umgehen zu können? Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig und fordert ein komplexes Denken, denn Einsatzgeschädigte, so wie alle die divers sind, führen zu einer höheren Komplexität der Situation. Daraus resultiert ein weiterer ganz entscheidender Aspekt und da sind wir wieder beim Thema Diversity: es wäre viel einfacher, wenn alle gleich wären!
Es gibt Streitkräfte, die fördern dieses Prinzip: Erst einmal die Individualität so weit zu reduzieren wie möglich und dann aus dem Nichts möglichst gleichgeschaltete, gleich orientierte Soldaten aufbauen. Das hat durchaus positive Effekte – ein aus gleich denkenden und handelnden SoldatInnen bestehender Verband ist leicht zu führen. Diesen Weg gehen wir in der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich nicht. Wir wollen den mündigen Bürger, wir erwarten und sind uns sicher, dass die Integration diverser Personen in die Streitkräfte Vorteile mit sich bringt. Und dazu gehören auch und erst recht SoldatInnen, die Einsatzschäden erlitten haben. Dennoch muss ein Weg gefunden werden, wie mit diesem Thema umgegangen wird.

Lösungsansätze
Aus meiner Sicht gibt es dazu drei Ansätze. Zunächst ist es sinnvoll, sich wann immer es geht in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen. Das ist schwierig, da Gesunde nur begrenzt nachempfinden können, wie schlecht es den Erkrankten geht. Trotzdem ist es notwendig, auch um sich die Frage zu stellen, was man als Einsatzgeschädigter vom eigenen Umfeld (KameradInnen und Vorgesetzte) erwarten würde.
Ein zweites Prinzip ist, sich ein Stück weit bei dem Umgang mit Einsatzgeschädigten auch auf positive Seiten zu konzentrieren und nicht immer nur die Probleme zu sehen. Jeder Betroffene ist eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine Bereicherung für jeden Verband und jede Einheit der Bundeswehr. Trotz ihrer im Einsatz erlebten Traumatisierung verfügen sie über umfangreiche Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden sollte. Gleichzeitig können die Betroffenen über ihre Leidensgeschichte berichten und so Verständnis wecken, aber auch KameradInnen für den Umgang mit möglichen zukünftigen Konfliktsituationen sensibilisieren.
Der dritte Aspekt, der immer eine Rolle spielt, ist die Frage, wie in der Praxis ganz konkret mit Einsatztraumatisierten umzugehen ist. Hier zeigt sich ein gewisses Dilemma: einerseits will man ihnen genug Freiräume geben um sich auf die eigentliche Aufgabe – gesund und beruflich rehabilitiert zu werden – zu konzentrieren. Den langen, oft beschwerlichen Weg zum Ziel müssen die Betroffenen aktiv und konsequent gehen, Passivität ist dabei kontraproduktiv. Das muss den Einsatzversehrten, aber auch KameradInnen und Vorgesetzten klar sein. Diesen Prozess gilt es zu fördern. Einsatzgeschädigte wollen eine Aufgabe haben, sie möchten zum Erfolg der Streitkräfte und zum Auftrag beitragen. Diesem Wunsch sollte – soweit es dem jeweiligen Einsatzgeschädigten möglich ist – Rechnung getragen werden. Dann reden wir über Inklusion und die Thematik Einsatzschädigung nicht nur als Herausforderung, als Problem, sondern auch als Chance zu sehen. Und erst dann, so ist meine feste Überzeugung, werden wir der Verantwortung gerecht, tatsächlich Kameradschaft, Solidarität und Fürsorge umzusetzen.
Ausblick
Zuletzt noch ein kleiner Blick in die Gesellschaft. Wir sprechen hier keinesfalls über ein Thema, dass ausschließlich die Bundeswehr betrifft. Generell steht die Frage nach dem gesellschaftlichen Umgang mit Behinderten, mit Menschen mit Einschränkungen, im Raum. Der Begriff „Behinderung“ passt dabei nicht wirklich, da er signalisiert, dass jemand auch von außen (also von anderen Menschen und Einschränkungen) behindert wird.
Analog zur Bundeswehr, die auf Leistung und höchstmögliche Einsatzbereitschaft orientiert ist, gilt das auch für die Gesellschaft. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, in der eingeschränkte Menschen am Rande stehen und Probleme haben, anerkannt zu werden. Probleme haben, mit ihren Fähigkeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten tatsächlich in das Leben integriert zu werden. Und genauso, wie sich die Bundeswehr damit auseinandersetzen und Wege finden muss, wie das am besten gelingt, sind wir insgesamt als Gesellschaft gefordert, uns diesem Thema zu stellen. Ziel muss es sein, KameradInnen und Menschen mit Einschränkungen zurück ins Leben und damit in eine Zukunft angemessen zu begleiten und zu unterstützen. Wenn uns das gelingt, wir dabei Fortschritte erzielen, so tut das der gesamten Gesellschaft gut und wird für uns alle es einen positiven Effekt haben.
Anmerkung der Redaktion: Generalarzt Dr. Hoffmann wurde nach Verfassen des Manuskriptes zum Bundeskanzleramt abkommandiert. Das Büro des Beauftragten PTBS kann weiterhin unter der Adresse [email protected] kontaktiert werden.
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2022
Generalarzt Dr. R. Hoffmann
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
E-Mail: [email protected]