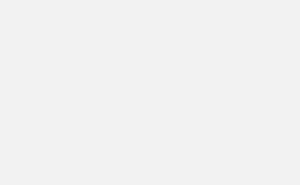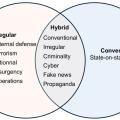„ICH HABE GROSSES GLÜCK GEHABT“
Im Gespräch mit HFW Boris Schmuda und Ehefrau Dorothee
Am 19. Mai 2007 sprengte sich ein Selbstmordattentäter auf einem Markt in Kundus in die Luft. Er tötete drei Bundeswehrsoldaten und fünf Afghanen. Dazu wurden zwei Deutsche schwer verwundet. Einer von ihnen war Hauptfeldwebel Boris Schmuda, den zahlreiche Splitter trafen. Er wurde noch am selben Tag notoperiert und lag fünf Tage lang im künstlichen Koma. „Die medizinische Versorgung in Kundus und im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz sucht ihresgleichen“, lässt Schmuda keinen Zweifel an der Qualität der ärztlichen Betreuung. Über die medizinische und psychologische Versorgung und die Zeit nach dem Anschlag sprach Oberstarzt Dr. Andreas Hölscher für die „Wehrmedizin und Wehrpharmazie“ mit Hauptfeldwebel Boris Schmuda und seiner Frau Dorothee.
WM: Herr Schmuda, wenn Sie heute an den Anschlag zurückdenken, was ist jetzt in Erinnerung geblieben und wie geht es Ihnen heute:
HFw Schmuda: Mir geht es gut. Aber es war ein langer Weg dorthin. Wenn ich an den Anschlag zurückdenke, dann ist da zunächst einmal der laute Knall. Direkt nach dem Anschlag wurde ich durch einen Kameraden erstversorgt. Gott sei Dank hat er mir zuerst die Beine versorgt, die sehr schwer verletzt waren und wir haben jetzt gerade erfahren, dass die Verletzung der Beine doch ein sehr großes Problem waren. Er hat versucht, die Blutung ein bisschen zu stillen und von der wirklich anlaufenden Rettung habe ich eigentlich nur im Augenwinkel die Fahrzeuge vorfahren sehen. Ein Arzttrupp, die Feldjäger, die alle vorfuhren, und dann kam auch schon der erste Arzt, hat mich auf die Trage gelegt und mir gesagt, wir kümmern uns um alles, alles okay; dann haben sie mich zugedeckt, dann habe ich eine Spritze bekommen und dann war erst einmal Feierabend. Das nächste, was ich dann wirklich real wieder weiß, ist, dass ich in Koblenz im Bundeswehrzentralkrankenhaus erwache am Donnerstag nach dem Anschlag.WM: Wann haben Sie wirklich realisiert, dass Sie einem schweren Anschlag zum Opfer gefallen sind?
HFw Schmuda: Recht schnell, glaube ich. Ich habe als erstes meine Frau gesehen, und zwei, drei Ärzte standen um mich herum. Wir haben uns ganz kurz unterhalten und dann wollte ich, so glaube ich, aufstehen, weil ich auf Toilette musste. Ich konnte aber nicht aufstehen, weil ich ja mit 8 Schläuchen ans Bett gefesselt war und da wurde mir dann schlagartig bewusst, das ist schwerer. Was passiert war und wo ich war, wusste ich nicht ganz genau, da musste man mir etwas helfen. Aber dann wusste ich auch sofort wieder, was passiert war, die Erinnerung war sofort da. Ich habe sofort gesehen, meine Frau ist da, die Ärzte sind da, und man hat mir gesagt, ich bin in Koblenz, in Deutschland. In dem Moment wusste ich sofort von dem Anschlag, da musste mir keiner mehr sagen, was passiert ist, die Erinnerung war sofort da. Und ich wusste direkt, was passiert war in dem Moment, wo ich dann gespürt habe, du kannst dich gar nicht bewegen, du bist komplett ans Bett gefesselt. Da ist mir sofort bewusst geworden, jawohl, dich hat es schwer erwischt. Ich glaube, einer meiner ersten Gedanken war, ob ich ein bisschen meine Beine bewegen kann und hab geschaut, ob noch alles dran ist. Das war für mich eine sehr große Sorge, die mich auch die Tage danach sehr bewegt hat. Ich hatte immer noch große Angst, dass ich noch mein Bein oder beide Beine verliere. Es war für mich erst mal eine große Erleichterung, zu sehen, ich kann ein bisschen zucken. Ich sehe meine Hände, ich sehe meine Füße dahinten, ich kann sie ganz leicht bewegen. Das war für mich eine riesige Erleichterung! Selbst nach dem Aufwachen, als man mir gesagt hat, alles wird gut, selbst da habe ich noch große Sorgen gehabt, was mit meinem Bein wird, dass es vielleicht doch noch abgenommen werden muss. Das hatte sich lange in mir festgesetzt.
WM: War Ihnen zu diesem Zeitpunkt bewusst oder konnten Sie sich noch daran erinnern, dass bei dem Anschlag drei Kameraden getötet worden sind?
HFw Schmuda: Bei dem Anschlag selber lag ich ja, ich konnte deshalb nicht so viel überblicken, nur die beiden Soldaten wahrnehmen, die nur ein, zwei Kratzer hatten und die die ganze Versorgung übernommen haben. Der eine hat sich um den anderen Schwerverletzten gekümmert, einer um mich, und gleichzeitig versucht, die Lage abzusichern. Sie haben die Afghanen daran gehindert, die Leichen abzutransportieren, denn die wollten die Leichen mitnehmen. Da kam gleich ein Wagen vorgefahren, der die hinten raufschmeißen wollte und mitnehmen wollte. Und der Übersetzer, der uns begleitet hat, an den kann ich mich noch gut erinnern, wie er neben einem Soldaten steht und dem sagt: Er soll die Leichen liegen lassen oder ich schieße. Ich kann mich noch gut an dieses Bild erinnern. Er hatte eine leicht zerfetzte Hose und mehrere Verletzungen am Bein und da sind die Leute, die ich wahrnehmen konnte und natürlich die ganzen Leute, die um mich herumstanden. Afghanen, Polizisten, Leute, die Fotos gemacht haben und Filme gedreht haben. Die haben mich auch ein bisschen abgelenkt. Wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich durchaus das eine oder andere sehen können. Aber ich war so geschockt, dass die um mich herumstanden, also mit denen hatte ich nicht gerechnet, dass ich das eine oder andere nicht mehr wahrgenommen habe. Ich meine, ich könnte mich aber auch täuschen, Soldaten da noch liegen gesehen zu haben, aber das kann auch eine Erinnerung sein, die dann einfach später durch Erzählungen entstanden ist, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die wirklich gesehen habe. Aber in diesem Moment war mir erst mal nicht klar, dass drei gestorben sind. Ich wusste immer, wie viel wir waren und hab dann im Krankenhaus ganz schnell sofort nach dem Aufwachen gefragt, was ist mit den anderen. Meine Frau, und da bin ich ihr auch sehr dankbar, hat gesagt, ich lüg ihn nicht an, wenn er mich fragt, was mit den anderen ist. Deswegen habe ich sehr schnell danach gefragt und dann hat meine Frau sofort gesagt, was wirklich passiert ist. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass drei Kameraden gestorben sind.WM: Wie lernten Sie mit der Situation umzugehen, dass drei Kameraden, mit denen Sie auch befreundet waren, ums Leben gekommen sind?
Im Film „Willkommen zuhause“ konnte Ben Winter mit der Situation, dass sein Kamerad Torben ums Leben gekommen überhaupt nicht umgehen. Doch das war ja eine ganz andere Situation. Die beiden haben geknobelt, wer von ihnen rausgeht. Das war ja bei Ihnen eine ganz andere Ausgangssituation. Sie waren alle in der gleichen Lage, und der Anschlag hätte für Sie auch anders ausgehen können.
HFw Schmuda: Das ist sehr, sehr schwer. Also das war etwas, was mir gerade in der ersten Zeit sehr zu schaffen gemacht hat, weil man hat natürlich eine gewisse Freude gespürt, als man merkte, jawohl, du hat den Anschlag überlebt, du bist in Deutschland, deine Frau ist bei dir. Das sind Glücksgefühle natürlich, die entstehen und gleichzeitig unglaubliche Trauer und Entsetzen, dass drei Kameraden gestorben sind.
Die drei, die man gut kannte, die man mochte und mit denen man unheimlich viel Zeit verbracht hat, und dass man selbst überlebt hat und die eben nicht. Dann kommen auch Schuldgefühle auf und natürlich fragt man sich auch, warum habe ich überlebt und die nicht. Ich wusste, die drei standen eigentlich zwischen der Bombe und mir, dem Attentäter und mir und dann kommen auch Gedanken, die drei haben es abgefangen. Was wäre, wenn es andersherum gewesen wäre? Da sind eine Menge Gedanken, die einem zu schaffen machen. Man ist ohnehin in einem sehr labilen geistigen Zustand. Ich habe immer geschwankt zwischen glücklich sein, dass man es bis hierher geschafft hat und der Frage, darf ich mich überhaupt darüber freuen? Schuldgefühl und Trauer, aber auch Freude und Glück, diese Gefühle waren immer vorhanden.
WM: Sie sprachen über Schuldgefühle. Im Film hat der behandelnde Arzt Ben Winter gesagt: du hast keine Schuld! Und durch die Therapie hat er es auch akzeptiert. Wie haben Sie es geschafft, sich von diesem natürlichen Schuldgefühl zu befreien ?
HFw Schmuda: Es ist wirklich etwas, was sehr schwierig ist, was auch mit am längsten gedauert hat und was mich sehr lange verfolgt hat. Gerade diese Schuldgefühle, die immer wieder hochkamen, auch wenn man eigentlich geglaubt hatte, das hat man nun hinter sich, aber die kamen immer wieder hoch und in erster Linie wie bei allen Sachen hat mir das Reden mit meiner Frau natürlich geholfen. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen, aber letztendlich die wirkliche Überwindung hat mir mein Psychologe dann im Krankenhaus genommen. Er hat mir geholfen, die wirklich hinter mir zu lassen, weil er mir eine Sichtweise einfach gegeben hat, wie ich es betrachten muss und mir auch ganz klipp und klar dann gesagt hat, wo ich da falsch liege. Diese Kombination hat dann langfristig dazu geführt, mich davon zu lösen, wobei ich aber auch sage, das ist etwas, was man nur ganz schwer los wird, was auch sehr lange dauert. Selbst heute, wenn ich in einem ruhigen Moment darüber nachdenke, spüre ich trotzdem immer noch eine gewisse Verantwortung. Nicht, das etwas passiert ist, aber das man es hätte anders machen können, hätte es verhindern können, das kommt durchaus immer noch mal hoch. Es ist nicht so massiv, dass es mich aus der Bahn wirft oder dass es mich irgendwo bedrängt, aber im ruhigen Moment, wenn man über die Dinge nachdenkt, ist das durchaus ein Gedanke, der nicht völlig verschwindet. Der ist sehr klein und sehr im Nebel, aber es ist etwas, was einen sehr lange nicht loslässt. Weil auch die Verantwortung da ist für die drei, die gestorben sind, die es zu schützen galt. Das war unser Auftrag und den haben wir an diesem Tag nicht erfüllt und das ist auch für einen Soldaten etwas, womit man erst mal fertig werden muss.
WM: Es war also nicht nur das Schuldgefühl, die sind gestorben und ich habe überlebt, sondern ich habe meinen Auftrag nicht erfüllt?
HFw Schmuda: Wir haben sie nicht geschützt und da denkt man natürlich auch, hättest du etwas vielleicht anders machen müssen, hättest du irgendetwas sehen können, hättest du irgendetwas verhindern können? Das sind natürlich Gedanken. Also nicht nur die Seite, ich habe es geschafft und die nicht, sondern auch: das war unser Job, deren Leben zu schützen und das haben wir nicht geschafft und das hinterlässt Spuren.
WM: Frau Schmuda, sie sind ja von jetzt auf gleich aus dem normalen Leben gerissen worden, als ihr Mann bei dem Anschlag schwer verletzt wurde. Wie haben Sie das alles gemanagt, ohne Vorbereitung so stark zu sein?
Frau Schmuda: Das frage ich mich heute auch. Ich weiß es nicht. Ich denke, bei mir war es eine Schutzfunktion, da ist irgendetwas aktiviert worden. Über einen ganz langen Zeitraum, mindestens ½ Jahr habe ich organisiert, nebenbei gearbeitet, Vollzeit, eigentlich alles? Die Kraft kam einfach so. Davon wollten wir uns nicht unterkriegen lassen, andere Leute schaffen es auch.
WM: Welche Unterstützung hatten Sie in der Familie, von Freunden? Ihr Mann war ja nach dem Anschlag in allen Medien, wie ist man da mit Ihnen umgegangen? Das stelle ich mir für Außenstehende, die das überhaupt nicht ermessen können, sehr schwierig vor.
Frau Schmuda: Ganz wichtig sind die Familie und die Freunde, man kann sein Leid streuen. Leid kann man nicht auf eine Person aufteilen, sondern man muss es Tröpfchenweise auf diese Personen verteilen. Auf der Arbeit hatte einerseits Verständnis am Anfang, aber später: warum funktionierst du nicht so schnell wieder? Da war das Verständnis dann nicht mehr da. Es ist doch alles okay, er lebt, wo ist das Problem?
Das ist schwer, weil viele können nicht umschalten, dass es nicht in 2 Monaten, nicht in 5 Monaten und auch nicht in 1 ½ Jahren erledigt ist und das verstehen sie nicht in Bezug auf PTBS. Sie kennen es nicht, verstehen es nicht.
WM: Wie reagieren Sie auf Kommentare, dass Ihr Mann als Soldat doch selbst Schuld hat, wenn er nach Afghanistan geht.
Frau Schmuda: Ich reagiere darauf nicht, weil dazu fällt mir nichts mehr ein, da kann man auch nichts mehr zu sagen, weil ich absolut anderer Meinung bin. Warum ich meinen Mann unterstützen würde, habe ich auch bei Beckmann gesagt. Wenn er da wieder hin will, das ist sein Auftrag, seine Berufung, sein Leben, dann würde ich ihn nicht daran hindern. Das wäre das gleiche, wenn jemand ein Hobby hat und ich würde sagen, mach das doch nicht. Der würde mir kaputtgehen.
WM: Herr Schmuda, körperlich sind Sie ja relativ gut wiederhergestellt. Sie haben allerdings bleibende Schäden, tragen beidseitig Hörgeräte. Auch das Lauftraining haben sie wieder intensiv aufgenommen. Sind Sie schon wieder an Ihre alte Form herangekommen?
HFw Schmuda: Nein, da geht schon noch ein bisschen was. Ich habe auch gedacht, das geht schneller, aber ich brauche noch ein bisschen Geduld. Was die Geschwindigkeit angeht, ist es schon wieder ganz okay, aber die lange Strecke, da fehlt schon noch was. Aber man muss ja auch noch Ziele haben, ein bisschen was am Horizont sehen.
WM: Können Sie sich vorstellen, nach allem, was Sie erlebt haben, irgendwann wieder in den Einsatz zu gehen?
HFw Schmuda: Wenn es nach mir ginge, ja! Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, es nicht zu tun, ich würde mich auch als Soldat zweiter Klasse fühlen. Ich bin Berufsoldat, ich bin Hauptfeldwebel, ich muss ja vorangehen! Wenn ich nicht vorangehe, wer soll es dann machen? Ich kann doch nicht den Feldwebel, den Oberfeldwebel, den Zeitsoldat in den Einsatz schicken, der gefährlich ist, der eventuell nicht einmal so abgesichert ist wie ein Berufssoldat. Der vielleicht auch noch ganz andere Pläne nach der Bundeswehr hat und ich als Berufssoldat bleibe zu Hause sitzen? Das passt mit meiner Vorstellung und meinem Berufsverständnis einfach nicht zusammen. Das ist nun mal unser Auftrag und wenn wir den haben, dann möchte ich meinen Teil auch weiterhin dazu leisten. Allerdings muss ich ganz klar sagen, wenn meine Frau mir sagen würde, nein das kann ich nicht, was ich sehr gut verstehen würde, dann würde ich es auch nicht tun. Damit würde ich beruflich nicht glücklich werden, aber das würde ich für meine Frau tun, weil sie das absolut verdient hat und für mich an erster Stelle steht! Wenn sie sagen würde, nein, das geht nicht, ich kann dich nicht in den Flieger lassen und dich dahinfliegen lassen, nachdem, was passiert ist, dann würde ich es auch nicht tun. Sie hat da das absolut das letzte Wort. Wenn es wirklich mal soweit ist und sie sagt dann, nein, ich hab mich übernommen, ich kann das doch nicht, dann würde ich es auch nicht tun. Wenn sie aber sagt, jawohl, mach das, wir können das, wir schaffen das, dann würde ich es gern wieder tun.WM: Wenn Sie noch einmal an den Film „Willkommen zuhause“ denken und Ihre eigene Geschichte daneben stellen, was ist das Fazit für Sie?
HFw Schmuda: Es gibt so zwei oder drei Botschaften oder Dinge, die ich für wichtig erachte, die ich gerne sage, wenn ich dazu Gelegenheit habe. Ich habe das Glück gehabt, ich war körperlich schwer verletzt, dadurch habe ich von Anfang an eine ganz andere Aufmerksamkeit gehabt. Jemand, der keinen körperlichen Schaden hat, aber seelisch betroffen ist, und das muss ja auch kein Anschlag sein, denn so ein Einsatz bietet auch ansonsten genug Elend und Grauen, gerade diese Menschen brauchen jemanden, der ihnen zuhört und dafür Verständnis hat. Gerade bei den Menschen, die nicht körperlich verletzt sind und die nicht diese Aufmerksamkeit haben wie ich sie hatte, ist es so wichtig, dass man vor allem langfristig Verständnis und Geduld hat, wenn man merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Betroffene das selber zugibt und sich selbst eingesteht. Das ist, so glaube ich mit, am schwersten. Das ist die erste Barriere bei so einer Problematik, auch das zeigt der Film sehr gut! In meinen Augen ist es ist eine große Fehleinschätzung zu glauben, das, wenn ich zu meinen Freunden sage, ich habe ein Problem, ich muss mich behandeln lassen, ich gehe zum Psychologen, dass sich dann meine Freunde, meine Familie abwenden. Genau das Gegenteil ist der Fall, das zeigt dieser Film ganz hervorragend. Da, wo Ben Winter sich nicht helfen lässt, verliert er seine Familie, seine Freunde, seine schwangere Frau, er verliert sein gesamtes Umfeld. Und erst als er sich öffnet und sich Hilfe holt, dann kommt so langsam alles wieder zurück. Er hat Briefkontakt mit seiner Freundin, es wird wieder ein Leben aufgebaut. Erst dann, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, wenn ich mich öffne und sage, ich habe Probleme, mir geht es nicht gut, ich brauche psychologische Hilfe, nicht dann wenden sich die Leute ab, jedenfalls der Großteil, aber nicht die Menschen, die einem wirklich nahe stehen. Ich brauche gerade in so einer Situation Menschen, auf die ich mich verlassen kann und das ist auch ein guter Moment, wo man feststellt, was Freundschaften wirklich Wert sind. Aber ich muss mir selbst eingestehen, dass ich Hilfe benötige und ich muss mir selbst die Hilfe holen! Und ich muss ganz deutlich sagen, was ich brauche, damit mir wirklich geholfen werden kann. Und sei es eben diese Geduld und das Verständnis des Umfeldes, ob das beruflich ist oder ob privat.
Ich habe großes Glück gehabt, ich hatte überall großes Verständnis erfahren, was aber auch mit meiner persönlichen Situation zusammenhängt. Die Menschen, die das nicht haben, die keine Wunden aufzeigen können, die nicht irgendwelche Bilder zeigen können, hier, da habe ich gelegen, gerade die brauchen dann die Geduld und das Verständnis. Und sie brauchen es langfristig, denn die Problematik ist nicht nach wenigen Wochen oder Monaten vorbei. Und das dritte ist einfach davon wegkommen, das die psychische Problematik etwas Schlimmes ist, das man daran völlig zugrunde geht. Ich gehe nur zugrunde, wenn ich mir nicht helfen lasse. Wir haben die Erfahrung gemacht, je offener man damit von Anfang an umgeht, um so besser ist die Akzeptanz. Diese Offenheit glaube ich, nimmt vielen Menschen auch dann die Hemmung davor, mit dieser Thematik umzugehen.
WM: Frau Schmuda, Herr Schmuda, vielen Dank für das Gespräch und Ihre offenen und ehrlichen Antworten und weiterhin alles Gute für sie Beide.
Datum: 13.01.2009
Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2009/1