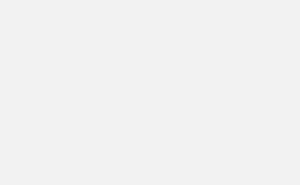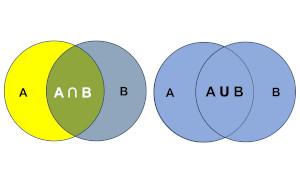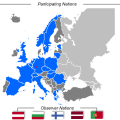INTERVIEW MIT BRIGADEGENERAL CHRISTOF MUNZLINGER, BEAUFTRAGTER PTBS DES BMVG
WM:
Herr General Munzlinger, zunächst ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, ein Interview mit der Zeitschrift WEHRMEDIZIN und WEHRPHARMAZIE zu führen. Seit über 2 Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Thematik „Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)“, haben dazu in den zurückliegenden Ausgaben immer wieder Artikel und Berichte veröffentlicht. Nun haben Sie sich dieser Thematik angenommen und wir möchten gerne mehr über Sie und Ihr neues Aufgabengebiet erfahren.
Brigadegeneral Munzlinger:
Ich bedanke mich, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mich und mein Team und unsere relativ neue Aufgabe vorzustellen. Ganz korrekt lautet die Bezeichnung für meine Tätigkeit „Beauftragter des BMVg für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte“ oder kurz „Beauftragter PTBS“. Das Aufgabenfeld umfasst also beide Aspekte, sowohl die körperlich als auch die psychisch Einsatzgeschädigten. Aber da das Kürzel PTBS ist mittlerweile in aller Munde ist und sich gut einprägt, kann ich damit gut umgehen. Die posttraumatische Belastungsstörung, also PTBS, wird im Verteidigungsausschuss des Parlaments ebenso diskutiert wie in den großen Medien und war sogar schon Motiv für Tatort-Folgen im Fernsehen zur besten Sendezeit. Das Thema ist mittlerweile in unserer Gesellschaft angekommen.
Aus der zugenommenen Komplexität sowie der höheren Intensität und Dauer der Einsätze der Bundeswehr resultieren deutlich gestiegene Anforderungen an den einzelnen Soldaten. Und wir müssen eine Zunahme körperlicher und psychischer Einsatzschädigungen bei dem eingesetzten Personal verzeichnen. Wir waren, als wir mit den Auslandseinsätzen begannen, auf diese Folgen versorgungsrechtlich, arbeitsrechtlich und sozialmedizinisch und mental, vor allem aber bei den Verfahren als Organisation noch nicht voll auf das eingestellt, was uns in den letzten Jahren zunehmend dort begegnet.
Die körperlichen, seelischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen waren für die betroffenen Soldatinnen und Soldaten, das Zivilpersonal, die Reservisten und auch die ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, aber auch für deren Familien oder Lebenspartner gravierend. Die Verfahren, um diese Konsequenzen aus den Auslandseinsätzen für den einzelnen Betroffenen abzufedern, waren oftmals langwierig, wenig transparent und wurden von den Betroffenen als zusätzliche Belastung und Kampf mit der Bürokratie empfunden. Das hat häufig zu Unzufriedenheit, Enttäuschung und sogar zu Rechtsstreit bei denen geführt, die den Eindruck hatten, es wird sich nicht angemessen um sie gekümmert. Das gilt für körperlich Versehrte und mehr noch für psychisch Traumatisierte, denen Formblätter und Vordrucke häufig zusätzliche Ängste verursachen. Auf all das haben Betroffene, Selbsthilfegruppen und Initiativen aktiver und ehemaliger Soldaten und auch der Bundeswehrverband intensiv hingewiesen und Einzelschicksale sind über die Medien öffentlich bekannt geworden und haben Aufmerksamkeit für die Problematik erzeugt.
Es gibt den Sanitätsdienst der Bundeswehr und die Bundeswehrkrankenhäuser, es gibt den Sozialdienst der Bundeswehr, die alle vorzügliche Arbeit leisten. Es gibt seit dem Jahr 2004 das Einsatzversorgungsgesetz und gottlob seit 2007 das Einsatz-Weiterver wen - dungsgesetz, beide aber leider häufig nicht bekannt. Und es gibt seit Mai 2010 das Forschungs- und Behandlungszentrum für Posttraumatologie und Posttraumatische Belastungsstörungen am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, das sogenannte Psychotrauma-Zentrum, es gibt Fachärzte, die auf ihrem Gebiet Kapazitäten sind, die bei zivilen Kongressen vortragen. Die Vertreter unserer Militärpsychiatrie genießen national wie international einen guten Ruf. Vor Ort in den Standorten gibt es als weiteres Hilfsangebot das Psychosoziale Netzwerk, in dem Truppenärzte, Truppenpsychologen, der Sozialdienst und die Militärseelsorge zusammen wirken. Oft ist die Regelung der Probleme des Alltags ja die Voraussetzung für eine gelingende Therapie und den Heilungserfolg.
Es gab eine Menge, es gibt eine Menge an Hilfestellung und Unterstützung für die körperlich und psychisch Verletzten und es hat sich ja auch schon eine Menge getan und verbessert, aber offensichtlich noch nicht genug. Manchmal sind die Maßnahmen nicht optimal koordiniert. Und es ist in Einzelfällen in der Tat auch schlecht gelaufen. Vor diesem Hintergrund habe ich im November 2010 meine neue Aufgabe übernommen. Das Einrichten einer solchen Funktion war ein Signal der Leitung des BMVg aus der Verantwortung des Dienstherren heraus, das zeigt, wie außerordentlich wichtig Fürsorge und Versorgung im Falle von Verwundung und Traumatisierung sind und das rasch für Verbesserungen gesorgt wird.
V.l.n.r.: OTA Dr. Andreas Hölscher, Chefredakteur; BG Christof Munzlinger, PTBSBeauftragter; Heike Lange, Verlegerin.WM:
Was ist nun konkret gefragt Ihr Auftrag und was sind Ihre Handlungsoptionen in diesem neu geschaffenen Amt?
Brigadegeneral Munzlinger:
Ich habe vier Einzelaufgaben. Der erste Auftrag ist die Bedarfsermittlung zur Entwicklung eines effizienten Vorsorge-, Betreuungs-, Behandlungs- und Versorgungsmanagements mit dem Ziel der Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe.
Zweitens habe ich aus dieser Bedarfsermittlung die aufbau- und ablauforganisatorischen Folgerungen abzuleiten und für die Bundeswehr heute und die Bundeswehr in der Neuausrichtung konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen.
Drittens habe ich die Leitung des BMVg in grundlegenden Fragen zu einsatzbedingten psychischen Erkrankungen einschließlich der posttraumatischen Belastungsstörungen zu beraten und zu informieren.
Und schließlich fungiere ich mit meinen Mitarbeitern als zentrale Ansprechstelle für den betroffenen Personenkreis mit der Aufgabe, Hilfestellung zu geben im konkreten Einzelfall in „Lotsenfunktion“ unter Nutzung des Psychosozialen Netzwerkes und aller betroffenen Stellen im BMVg und im nachgeordneten Bereich.
Dazu bin ich fachlich dem parlamentarischen Staatssekretär Kossendey mit unmittelbarem Vortragsrecht und truppendienstlich unmittelbar Staatssekretär Wolf unterstellt. Ich arbeite mit den Hauptabteilungen, Abteilungen und Führungsstäben in der Sache eng, unmittelbar und vertrauensvoll zusammen. In meinem Team werde ich derzeit unterstützt von einem Regierungsdirektor und Juristen, einem Hauptmann mit Lebens- und Einsatzerfahrung und nicht zuletzt, als ausgebildeter „Ersthelfer Bravo“, mit besonderer Affinität zum Sanitätsdienst sowie einem Oberstabsfeldwebel, der ebenfalls über Einsatzerfahrung verfügt.
WM:
Wie gehen Sie diese Aufgaben an?
Brigadegeneral Munzlinger:
Die Bedarfsermittlung ist ja nichts anderes als eine militärische Lagefeststellung. Dazu haben wir versucht, mit all den Stellen auf allen Ebenen innerhalb der Bundeswehr vor Ort zu sprechen, die im Rahmen der Ausbildung, der Einsatzvorbereitung, Einsatzdurchführung und Einsatznachbereitung sowie der Fürsorge, der medizinischen Behandlung, der Beratung, der Betreuung, der Versorgung und vor allem der Wehrdienstbeschädigungsver-fahren beteiligt sind.
Das reicht alleine beim Sanitätsdienst vom Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr über alle fünf Bundeswehrkrankenhäuser, das Sanitätsamt in München mit seinen begutachtenden Sozialmedizinern bis hin zu einzelnen Truppenärzten, die von sich aus mit uns Verbindung aufgenommen haben. Weitere wichtige Akteure sind die verschiedenen Referate in der Abteilung PSZ des BMVg, vom Grundsatz über den Sozialdienst, den psychologischen Dienst, den Berufsförderungsdienst, die Beauftragte für die Vereinbarkeit von Familie und Dienst bis zu den „Versorgern“ im BMVg und den beiden damit beauftragten Wehrbereichsverwaltungen Süd und West in Stuttgart und Düsseldorf. Auch mit dem Führungsstab der Streitkräfte und der evangelischen und katholischen Militärseelsorge haben wir gesprochen.
Die dabei gewonnenen Informationen und der weiterhin stattfindende Austausch zeigen, dass die Kräfte dieser zahlreichen Stellen und Instanzen gebündelt werden müssen, die Verfahren vereinheitlicht oder zumindest harmonisiert und in jedem Fall gestrafft werden müssen, die Dokumentation und der Informationsaustausch zu verbessern sind, um nur einige erste Erkenntnisse zu nennen.
Und natürlich haben wir uns auch beim Bundeswehrverband, dem Soldatenhilfswerk und dem Bundeswehrsozialwerk, dem Verband der Reservisten, dem Wehrbeauftragten und vielen Vertretern des Netzwerks der Hilfe mit seinen unterschiedlichen Initiativen und Selbsthilfegruppen informiert.
Ich war zwischenzeitlich auch in Dänemark, Großbritannien und bei unseren amerikanischen Partnern in Kaiserslautern, um mich dort über die Herangehensweise und den Umgang mit Verwundung und speziell auch PTBS zu informieren. Kurzbesuche in Norwegen und den Niederlanden sind geplant.
Von ganz besonderer Wichtigkeit und hoher Eindringlichkeit für unsere Lagefeststellung waren zwei Workshops, die wir im Auftrag von Staatssekretär Kossendey und auf Anregung Betroffener mit betroffenen aktiven und ehemaligen Soldaten, sowohl körperlich Verwundeten als auch an PTBS Erkrankten durchgeführt haben, um aus erster Hand deren positive und negative Erfahrungen zu hören. Bei dem zweiten Treffen am Zentrum Innere Führung in Koblenz kamen 15 Betroffene mit Fachleuten aus dem Ministerium, dem Amtsbereich und der Arbeitsebene für ein intensives Wochenende zusammen – ein Schlüsselerlebnis für die Patienten, vor allem aber auch für die „Helfer“ und Experten. Hier wurde allen klar: Zuhören, Wertschätzen, Ernstnehmen, Respekt, Geduld, Verlässlichkeit und eindeutige Information sind im Umgang mit körperlich und seelisch Versehrten gleichermaßen wichtig und notwendig. Und es wurde überdeutlich: Hilfe und Fürsorge brauchen eine Stimme und ein möglichst vertrautes Gesicht.
Darüber hinaus wurden und werden wir als Team vom Oberstabsfeldwebel bis zum General sehr schnell von Betroffenen selbst oder deren Partnern, Vorgesetzten, Kameraden, Truppenärzten und häufig von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialdienstes und auch von Abgeordneten des Deutschen Bundestages als Ansprechstelle in Anspruch genommen. Dabei werden wir mit zahlreichen Einzelschicksalen konfrontiert und haben häufig in enger Zusammenarbeit mit unserem mittlerweile entstandenen Netzwerk helfen können, aber dabei auch exemplarische Mängel und Schwächen des Systems entdeckt.
Aus dieser Lagefeststellung heraus wurde rasch deutlich, dass wir eine Art Runden Tisch der Experten zusammenzubringen mussten, der die gesammelten Erkenntnisse systematisch aufarbeitet, mit der jeweiligen Fachexpertise bewertet und wo möglich, quasi in der Bewegung, systembedingte Mängel abstellt oder konsolidierte Vorschläge für grundsätzliche Verbesserungen in der Zukunft erarbeiten kann. Das ist mit der Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung (ARGE PSU) geschehen. Wir kommen in diesem Kreis einmal im Monat in Bonn oder Berlin zusammen und bearbeiten dabei nicht nur grundsätzliche Fragen, sondern besprechen in dieser Expertenrunde auch schwierige Einzelfälle. Es herrscht Einvernehmen, wir wollen für die Sache der im Einsatz Traumatisierten die vorhandenen Kräfte bündeln und fokussieren. Synergie ist nach meiner Erfahrung von fast 40 Dienstjahren der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg. Deshalb bin ich zuversichtlich, der Leitung des BMVg bis zum Herbst einen ersten abgestimmten Bericht mit dem Ergebnis der Lagefeststellung und Bedarfsermittlung sowie mit konkreten Vorschlägen für Verbesserungen vorlegen zu können.
WM:
Was muss denn Ihrer Meinung nach weiter verbessert werden?
Brigadegeneral Munzlinger:
Die Gesetzesinitiative zur Verbesserung der Regelungen zur Einsatzversorgung ist auf den Weg gebracht. Sie beinhaltet zahlreiche konkrete Verbesserungen, die im Deutschen Bundestag im Oktober 2010 als Forderungen beschlossen worden sind, wie beispielsweise die Erhöhung der Einmalzahlung von 80.000 Euro auf 150.000 Euro oder die Anpassung der Stichtagsregelung von Dezember 2002 auf Juli 1992. Da stimmt die Richtung.
Denn wir wissen, die Bundeswehr ist schon seit 1993 in Auslandseinsätzen, zunächst in Kambodscha, dann 1994 in Somalia, danach kam der Balkan. Durch die Stichtagsregelung, die bisher gilt, sind ja aktive, vor allem aber ehemalige Soldaten sozusagen per Gesetz ausgegrenzt und müssen sehen, dass sie ihre versorgungsrechtlichen Ansprüche durchsetzen. Wir sind jetzt dabei, dass wir die Möglichkeiten des Einsatzweiterverwendungsgesetzes, eine Wiedereinstellung und einer Therapie im Rahmen der freien Heilfürsorge denen, die es nötig haben, berechtigterweise auch dann zukommen lassen können, wenn das Schadensereignis bereits vor 2002 eingetreten ist und sie auch in den Genuss der Regelungen des Einsatzversorgungsgesetzes kommen können.
Nachholbedarf haben wir in der Verbesserung und Beschleunigung der WDB-Verfahren. Das beginnt bei der Dokumentation des Schadensereignisses im Einsatzland. Ein IED-Anschlag ist meist umfassend dokumentiert, die Betroffenen und Zeugen namentlich erfasst und die Meldungen gehen an alle beteiligen Stellen, die die notwendigen Informationen auf ihrem jeweiligen Fachstrang benötigen, unmittelbar aus dem Einsatzland heraus bis nach Deutschland, um rasch und umfassend im Interesse der Verwundeten tätig werden zu können. Bei scheinbar weniger dramatischen Vorkommnissen ist es um die Dokumentation leider immer noch weniger gut bestellt. Wie soll ein ehemaliger Zeitsoldat mit einer Vielzahl von Einsätzen, bei dem sich Jahre nach seinem Ausscheiden eine PTBS zeigt, das schädigende Ereignis benennen oder glaubhaft machen, wenn es keine aussagekräftige Ereignisdokumentation aus dem Einsatz gibt, auf die die Ärzte und die am WDB-Verfahren beteiligten Stellen rasch zugreifen können. Gleiches gilt häufig auch in solchen Fällen für unsere Reservisten.
Dringenden Verbesserungsbedarf haben wir auch in der Tat bei genau dieser Gruppe der ehemaligen Zeit- und Berufssoldaten und den Reservisten, wenn es um die zeitkritische Prüfung der Verlängerung der Dienstzeit oder die Aufnahme in ein Dienstverhältnis besonderer Art und die zeitlich befristete Wiedereinstellung im Rahmen der Schutzzeit des Einsatzweiterverwendungsgesetzes geht. Die WDBVerfahren dauern unter dem Strich häufig zu Lasten der Betroffenen zu lange, weil viele Einzelschritte im Zusammenspiel der Geschädigten, ihrer Vorgesetzten, der Wehrbereichsverwaltung, der Sozialmediziner des Sanitätsamtes und möglicher Außengutachter in der Summe viel Zeit brauchen – vor allem bei psychischen Schädigungen. Wir müssen die Übernahme in die Schutzzeit aus akuten medizinischen Gründen mit dem Ziel der schnellstmöglichen Behandlung und hoffentlich Heilung von der längerfristigen Frage der Versorgung und Bestimmung eines Grades der Schädigung im Rahmen eines WDB-Verfahrens deutlicher trennen und beispielsweise eine vorläufige Übernahme in die Schutzzeit, zur Not zunächst auch ohne Anspruch auf Berufsförderung anbieten.
Sind die Soldaten erst einmal aus dem Dienst ausgeschieden oder ist die Wehrübung des Reservisten, in der er im Einsatz war, beendet, dann endet zunächst auch die Zuständigkeit der Bundeswehr für die soziale und medizinische Versorgung und nach unserer Sozialgesetzgebung werden die Versorgungsämter der Bundesländer oder die entsprechenden kommunalen Einrichtungen zuständig.
Dort, im zivilen Umfeld, werden die Betroffenen im Regelfall nicht auf das Verständnis stoßen, das ihnen in der Bundeswehr hoffentlich überall begegnet. Deshalb bemüht sich das BMVg in Verhandlungen mit den Ländern mit der Zielrichtung „Versorgung aus einer Hand“, die Zuständigkeit für ehemalige Angehörige der Bundeswehr in solchen einsatzbedingten Versorgungsfragen von den Versorgungsämtern in die Bundeswehr zurückholen.
WM:
Wie passt Ihre Aufgabe in die anstehende Neuausrichtung der Bundeswehr?
Brigadegeneral Munzlinger:
In der Neuausrichtung liegt in der Tat eine Chance für positive Veränderungen. Unsere Lagefeststellung hat ja heute schon Veränderungsbedarf aufgezeigt. Es gibt Redundanzen, aber auch Lücken, teilweise komplizierte und langatmige Bürokratie, mangelnde Dokumentation oder erschwerten Zugang dazu, weil Verbände und Einheiten aufgelöst und die Aktenbestände noch nicht aufgearbeitet sind, es gibt Anpassungsbedarf in der Personalauswahl und der Ausbildung, organisatorisch bedingt lange Bearbeitungszeiten und in manchen Bereichen eine Schere zwischen Auftrag und Mitteln.
Mein Ziel ist es, mich mit meiner Aufgabe als Beauftragter PTBS so schnell wie möglich überflüssig zu machen, spätestens dann, wenn Organisation und Verfahren auf die bestmögliche Versorgung der im Einsatz zu Schaden Gekommenen optimiert sind. Deshalb ist es für mein Team und mich wichtig, neben der täglichen taktisch-operativen Arbeit als Ansprechstelle in Einzelfällen die strategische Aufgabe der Beratung der Leitung und derjenigen, die die Neuausrichtung der Bundeswehr konkret planen und umsetzen, nicht aus den Augen zu verlieren.
WM:
Der Leser fragt sich vielleicht, warum ist ein Truppengeneral PTBS-Beauftragter. Das müsste doch eigentlich vom Verständnis her ein Sanitätsoffizier sein. Was qualifiziert Sie persönlich für diese Aufgabe?
BG Munzlinger:
Ich bin fast 40 Jahre Soldat, habe fünf erwachsenen Kinder, zwei meiner drei Söhne haben in der Bundeswehr gedient. Ich war als Brigadekommandeur mit meiner Truppe im Einsatz. Ich habe das großartige Engagement meiner Soldatinnen und Soldaten und auch der zivilen Mitarbeiter in der Ausbildung und im Einsatz erlebt. Und ich habe in Afghanistan die Bedeutung und die großartige Leistung der Sanität der Bundeswehr im Einsatz intensiv wahrgenommen und besonders zu schätzen gelernt. Als Beauftragter des Generalinspekteurs für Ausbildung und Erziehung hatte ich in den vergangenen drei Jahren das große Privileg, die Streitkräfte und alle Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche auf allen Führungsebenen in der Ausbildung im In- und Ausland und jedes Jahr alle unserer Einsatzgebiete zu sehen. Das was ich dort erfahren habe, das verpflichtet. Davon gebe ich jetzt in meiner Verwendung ein Stück zurück. Und deshalb mache ich meine Arbeit aus Überzeugung und mit einer Grundempathie.
Von einem Arzt erwarte ich in erster Linie professionelles, medizinisch-handwerkliches Können. Wenn Empathie dazukommt, ist das gut. Bei mir als Nicht-Mediziner, aber als Ausdruck der Fürsorgeverpflichtung des Dienstherren muss Empathie nach meiner Auffassung dazugehören. Als Soldat und als Führer, der selbst im Einsatz war, der selbst erlebt hat, dass man verändert zurückkommt, geht es mir auch darum, Angst zu nehmen und sich mit diesen Veränderungen an einem selbst, dem Untergebenen oder dem Kameraden offen umzugehen. Auch und gerade PTBS muss weiter enttabuisiert und entstigmatisiert werden. Deswegen bin ich mir für diese Arbeit auch nicht zu schade, im Gegenteil. Ich weiß, PTBS ist nicht der Nabel der Welt, aber ich weiß mittlerweile auch, der, der darunter leidet und sich nicht öffnet, weil er berufliche Nachteile fürchtet oder gesellschaftlichen Druck oder Hänseleien seiner Kameraden, für den wird das Leben zur Qual. Und als Kamerad und als Vorgesetzter will ich das nicht. Ich weiß, dass mittlerweile viele so denken und sich für die im Einsatz Versehrten nachhaltig engagieren. Die Teilnehmer an dem angesprochenen Workshop am Zentrum Innere Führung haben das auch so erlebt.
Wenn ein Soldat oder ein Vater einer Soldatin den Mut geschöpft hat und einen wildfremden General anruft, dann herrschen dort Not und Leidensdruck. Daraus entwickeln sich häufig Telefongespräche von 20 Minuten, einer halben Stunde oder länger. Wir spüren: Schon das Zuhören entlastet und hilft dem Anrufer. Und das zu uns gefasste Vertrauen verpflichtet meine Mitarbeiter und mich und darf nicht enttäuscht werden. Wir müssen manchmal auch unangenehme Wahrheiten aussprechen. Wir können und dürfen nichts versprechen, was wir nicht einlösen können. Wir versprechen nur, dass wer sich mit uns in Verbindung setzt bis zum Ende des folgenden Werktages eine erste Rückmeldung erhält. Schon das ist ambitioniert.
WM:
Sie haben gesagt, im Grunde müsste man Sie korrekterweise als Ombudsmann für Einsatztraumatisierte bezeichnen. Unter welchen Umständen können denn Soldaten noch traumatisiert aus dem Einsatz kommen?
BG Munzlinger:
Bei Einsatztraumatisierten handelt es sich sowohl um Soldaten mit einer körperlichen Verwundung, als auch um Soldaten mit einer psychischen oder seelischen Schädigung. Ein Verwundeter nach einem Anschlag oder nach einem Feuergefecht ist mir genauso wichtig wie der, der unter einer PTBS leidet, die erst Monate oder sogar Jahre nach Einsatzende akut wird. Und das gilt es auch zu enttabuisieren. Die Verwundung, die man sieht, ist offensichtlich, eine Wunde, einen Verband kann man sehen. Den Riss in der Seele dagegen sieht man nicht, und ein Röntgengerät, einen Scanner oder ein Ultraschallgerät, das die Seele scannt, die gibt es nicht. Trotzdem hat der an PTBS Erkrankte das gleiche Recht auf Behandlung und Anerkennung wie der körperlich Verwundete. Ich bin als Beauftragter für beide da. Bei den psychischen Erkrankungen von Soldaten in der Heimat und im Einsatz ist die PTBS zahlenmäßig nicht dominant. Depressionen, das Burn-Out-Syndrom, Anpassungsstörungen und Abhängigkeiten und Süchte wie Alkoholsucht, Drogensucht oder Spielsucht treten in der täglichen Praxis deutlich häufiger auf. Es gibt zum Beispiel akute psychische Belastungsreaktionen im Einsatz oder unmittelbar danach, die keine PTBS sind und auch nicht zu einer PTBS führen. Das typische und auch das tückische an der PTBS ist ja gerade, dass sie in zeitlicher Verzögerung zum traumatisierenden Erlebnis auftritt.
Aber wenn sie nach langer Latenz akut wird, hat man häufig schon die Schäden im Sozialbereich, weil die Ehe oder Partnerschaft leidet oder in die Brüche geht, der Partner ebenfalls erkrankt, das Eltern-Kind-Verhältnis untergraben oder gar zerstört ist und ganz allgemein Sozialkontakte gelitten haben. Dazu gehört auch das Verdrängen von Dingen des Alltags, die den Kranken hoffnungslos überfordern. Rechnungen werden nicht mehr bezahlt, es türmen sich ungeöffnete Briefumschläge mit Mahnungen und Pfändungsbeschlüssen. Das wiederum führt dann zu Alkoholmissbrauch oder anderen Komorbiditäten. So entsteht ein Teufelskreis, und eine Therapie wird schwierig oder sogar so lange unmöglich, bis diese Sekundär- Probleme beispielsweise mit Hilfe des Sozialdienstes gelöst sind. Aber die Fachmediziner sagen mir: PTBS ist heilbar. Je früher erkannt, je eher behandelt, desto größer die Chancen auf vollständige Heilung.
Um all das zu vermeiden oder frühzeitig zu reagieren, ist Prävention so wichtig. Dazu gehören Ausbildung, Aufklärung und Enttabuisierung der PTBS.
WM:
Herr General, Sie haben ja gerade einen wichtigen Punkt angeführt, das ist die Prävention. Wie weit spielen da die Truppenvorgesetzten eine Rolle? Wo muss da noch Aufklärungsarbeit geleistet werden?
BG Munzlinger:
Vorgesetzte haben auf diesem Gebiet wichtige Funktionen, und zwar geht es darum, dass der Vorgesetzte selbst sich mit der Thematik offen auseinandersetzt, das ist ein Muss. Das muss sachlich und unaufgeregt passieren. Vorgesetzte müssen über die Phänomene von Belastungen und Überlastung im Einsatz wie Battle-Stress, akute Belastung und posttraumatische Belastungsstörungen informiert sein. Sie müssen wissen, was dort physiologisch abläuft, sie müssen die Anzeichen von psychischer Überlastung erkennen, denn sie sind verantwortlich für die Einsatzbereitschaft ihrer Truppe. Aber jetzt kommt etwas, was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist. Vorgesetzte haben eine Vorbildfunktion. Sie müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, und zwar auch in der Diskussion, in der Ausbildung, am Rande der Ausbildung. Sie müssen ihre Soldaten kennen, um Veränderungen in der Persönlichkeit und im Verhalten wahrnehmen zu können. Jeder Soldat muss die Gewissheit haben, dass ihm geholfen wird und dass der Vorgesetzte ihn nicht im Stich lässt.
Die Vorgesetzten müssen also wissen, das kann meinen Soldaten, aber auch mir selbst passieren und vor dem Einsatz bereite ich mich und meine Soldaten deshalb darauf vor. Ich spreche darüber in der Ausbildung und im persönlichen Gespräch in der Pause. Und ich sensibilisiere meine Untergebenen, auf sich selbst und auf Kameraden zu achten, und wenn etwas auffällt in Richtung Belastung, Überlastung oder gar PTBS, spreche ich mit dem Betroffenen oder gebe Signal an das psychosoziale Netzwerk.
Bei der hohen Einsatzfrequenz, die beispielsweise bei unseren Infanterieverbänden besteht, bei der hohen Frequenz, der auch unsere Ärzte unterliegen, unsere Feldjäger und unsere Kampfmittelbeseitiger und sicherlich auch andere Spezialisten, wo nicht nur die Dauer, sondern auch die Intensität, die Gefährlichkeit und damit die Wahrscheinlichkeit mit traumatisierenden Erlebnisse konfrontiert zu werden höher ist, kommt es darauf an, dass die Vorgesetzten erkennen, wie wichtig auch eine Präventivkur für die betroffenen Soldaten und auf Dauer auch für die Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Einheit sein kann. Und ich bin froh, dass in den letzten drei Jahren die Zahl der Präventivkuren, und zwar nicht nur beantragten, sondern auch angetretenen und durchgeführten und genehmigten, exponentiell gestiegen ist seit 2000. Wir liegen jetzt bei einer Zahl im Jahre 2010 von über 3.000 Präventivkuren. Das ist wichtig und zeigt einen Bewusstseinswandel. Das Vorurteil, das sind „Warmduscher“, die so etwas brauchen, ist passé. Man hat weithin erkannt, auch der Stärkste ist nur endlich lange heftig belastbar. Und die individuelle Belastungsgrenze kann durch eine große Intensität der Belastung oder eine hohe Frequenz der Einsätze oder die Kombination von beiden überschritten werden.
Ich will damit sagen, auch die Akzeptanz bei Vorgesetzten ist deutlich gewachsen. Ich sehe immer wieder Vorgesetzte, die sich vorbildlich kümmern, aber eben auch noch andere, denen man die Möglichkeiten, die es heute schon reichlich gibt, ihrer Fürsorgepflicht zum Wohle ihrer einsatzgeschädigten Soldaten mit Unterstützung des psychosozialen Netzwerkes besser gerecht zu werden, aufzeigen muss. Da hilft auch ein Blick in ein kleines blaues Büchlein, die ZDv 10/1 Innere Führung und die Anlage 1 Leitsätze für Vorgesetzte, die sind so einleuchtend und hilfreich, die sollte jeder kennen. Und auf der Seite 45 steht etwas über ein Feld der Inneren Führung, nämlich die sanitätsdienstliche Versorgung. Da kann man lesen, dass die verantwortlichen Vorgesetzten für die bestmögliche Versorgung der Soldatinnen und Soldaten eng und vertrauensvoll mit dem Fachpersonal des Sanitätsdienstes zusammenarbeiten sollen. Vorgesetzte leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten. Und dazu kommt noch ein Hinweis auf das psychosoziale Netzwerk.
WM:
Herr General, eine Nachfrage: Wie sehen Sie unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vergleich zu anderen Nationen?
BG Munzlinger:
Ich möchte keine direkten Vergleiche anstellen oder gar Bewertungen abgeben. Ich bin unseren amerikanischen, britischen und dänischen Freunden dankbar, dass sie mir und meinem Team alle Türen geöffnet haben, dass wir uns bei ihnen informieren und umschauen konnten. Bei den Gesprächen in den Führungsstäben, den Behandlungs- und Rehabilitationszentren sowie den Betreuungseinrichtungen für Einsatzgeschädigte haben wir feststellen können, das wir sehr schnell auf ähnliche Erfahrungen und Herausforderungen zu sprechen kamen und das man auch an unserer Herangehensweise und dem Austausch von Forschungsergebnissen stark interessiert ist.
Im April wurden in Berlin von Prof. Dr. Wittchen von der TU Dresden die ersten Ergebnisse der sogenannte Dunkelzifferstudie zur Prävalenz und Inzidenz von traumatischen Ereignissen, PTBS und anderen psychischen Störungen bei Soldaten mit und ohne Auslandseinsatz vorgestellt. Erfreulich ist, dass die befürchteten hohen Zahlen nicht zutage traten, sondern mit etwa zwei Prozent deutlich geringer sind als bei Briten und Amerikaner. In Dänemark hat eine vergleichbare Studie in ersten Ergebnissen ebenfalls eine Rate von etwa zwei Prozent ergeben. Und wenn man sich fragt, warum haben unsere amerikanischen Verbündeten eine Rate von 20 – 25 Prozent an PTSB-Erkrankungen, warum haben unsere britischen Kameraden eine Zahl, die liegt bei etwa fünf Prozent, und warum liegen wir auch da noch deutlich darunter, gibt es aus meiner Sicht einige Faktoren, die zur Erklärung unserer Zahlen beitragen können ohne in einen Vergleich mit unseren Partnern einzutreten.
Neben der Art und Intensität der Einsätze wie etwa im Irak und im Süden und Osten Afghanistans und der Geschichte früherer britischer Einsätze wie Falkland und Nordirland oder dem ersten Golfkrieg gibt es sicherlich noch weitere Unterschiede, die einen direkten Vergleich geradezu verbieten. Wichtige Faktoren für eine niedrige PTBS-Rate sind sicherlich ein tragfähiges Wertesystem, die Anwendung der Prinzipien der Inneren Führung, aber auch eine gute Ausbildung und Einsatzvorbereitung, geregelte und verlässliche Pausen zwischen den Einsätzen sowie die Kohäsion der Truppe und die Qualität der sanitätsdienstlichen Versorgung. Dazu gehören sicherlich auch die Vermittlung interkultureller Kompetenz und das gedankliche Vorbereiten auf eine Situation 5.000 Kilometer entfernt von zu Hause sowie eine gute Betreuung der Familien in der Heimat.
Nach meiner Erfahrung sind unsere Soldaten, wenn sie gut vorbereitet in die Einsätze gehen, gefestigt und belastbar. Wenn man sieht, mit welcher Intensität wir uns noch immer auf die Einsätze vorbereiten, dann ist das auch ein Teil des Erfolgs. Aber eines muss uns auch bewusst sein: Eine Immunisierung durch Prophylaxe gibt es nicht. Deshalb ist der Sanitätsdienst im Einsatz und in Deutschland so wichtig. Für mich als Kommandeur im ISAF-Einsatz war der Sanitätsdienst immer mit ein Garant und eine Voraussetzung dafür, dass ich mit gutem Gewissen Patrouillen herausschicken konnte und auch selbst immer mit einem guten Gefühl rausgefahren bin. Für mich war die Sanität wie ein Netz. Wenn wir tags und nachts draußen unterwegs waren, dann war der bewegliche Arzttrupp mit dabei und wir wussten, wenn etwas schief geht, sind wir gut versorgt. Ich glaube, ich war fast täglich im Feldlazarett, um mich über die Kapazitäten und die Lage nicht nur der Patienten, sondern auch des Sanitätspersonals zu informieren.
Und so wie der Sanitätsdienst hat mich damals das psychosoziale Netzwerk unterstützt und getragen. Ich habe als Kommandeur mit dem Leiter des SanEinsatzverbandes, mit den beiden Militärgeistlichen, der Psychologin, meinem Chef des Stabes und dem G1-StOffz einmal pro Woche an der sogenannten „Lage Seele“ unter der Leitung der Psychologin teilgenommen. Da war nicht ich der Leitende, sondern ich konnte als Kommandeur zuhören und etwas über die innere Lage des Kontingents und auch vermeintliche Kleinigkeiten erfahren, die die Seele der Truppe und damit die Einsatzbereitschaft berührt haben und die ich selbst sonst so nicht wahrgenommen hätte.
Die Gewissheit, dass wenn dir im Einsatz etwas zustößt, du dich darauf verlassen kannst, dass du vor Ort bestens behandelt wirst, du ausgeflogen wirst unter medizinisch und menschlich erstklassigen Standards und es deine Kameraden sind, die sich um dich kümmern, ist unbezahlbar. Und wenn du dich darauf verlassen kannst, dass diese Rettungskette hält, von Afghanistan über Termez weiter bis nach Koblenz, Ulm, Berlin oder Hamburg, und auch da wirst du bestens behandelt und da bist du bestens aufgehoben, das trägt, glaube ich, mit dazu bei, dass die PTBS- Zahlen bei uns gottlob nicht so hoch sind.
WM: Herr General, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses sehr offene Gespräch.
Datum: 14.06.2011
Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2011/2