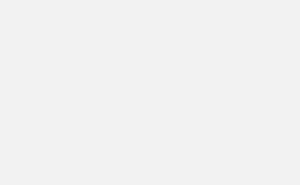„Das Entscheidende ... ist doch die Versöhnung.“
Im Gespräch mit dem Altinspekteur, Generaloberstabsarzt a. D. Dr. Karl Demmer (1941-2019) geführt am 3. März 2018 im Beta Verlag, Bonn
WM: Herr Generaloberstabsarzt Dr. Demmer, die Zeitschrift Wehrmedizin und Wehrpharmazie hat im März 2003, anlässlich Ihrer Zurruhesetzung das letzte Interview mit Ihnen geführt. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und tatsächlich sind Sie nicht nur Zeitzeuge, sondern auch ein tatkräftiger Gestalter in vielen entscheidenden Phasen der Geschichte des Sanitätsdienstes der Bundeswehr gewesen. Insofern freuen wir uns sehr, mit Ihnen eine Rückschau auf diese eingreifende Zeit zu nehmen.
Sie haben 1964 bis 1970 in Bonn und Köln Medizin studiert, in einer Zeit, in der die berühmte 68er Bewegung entstanden ist und die deutsche Gesellschaft maßgeblich gestaltet hat. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie sind Sie dadurch als Sanitätsoffizier geprägt resp. sozialisiert worden?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Die Zeit war damals für uns wirklich bewegend. Wir empfanden es als einen Abbruch alter traditioneller Verkrustungen in der Gesellschaft und das machte auch an den Universitäten nicht Halt, vielmehr ging dieser Aufbruch in eine neue Zeit sogar von den Studenten aus. Akademische Relikte, alte Zöpfe wurden über Bord geworfen und man getraute sich als Student plötzlich etwas zu sagen, seine Meinung zu äußern auch gegenüber den Professoren, die bis dahin sakrosankt gewesen sind. Ich habe es auch als eine bedeutende Erleichterung im zwanglosen Umgang miteinander empfunden, wenn auch die Protagonisten der 68er-Bewegung durchaus nicht nur ein leichteres Leben im Sinn hatten, sondern auch zum Teil sehr verbissen für ihre Argumente kämpften. In jedem Fall gelang es uns jungen Studentinnen und Studenten damals irgendwie durchzuatmen, weil durch diese Bewegung ein Prozess in Gang gesetzt wurde, offener gegenüber der eigenen erst kurz zurückliegenden Vergangenheit zu werden. Das Verschweigen der eigenen unheilvollen Geschichte hörte nun auf und die Aufarbeitung begann. Sie hält ja bis heute an. Das kam natürlich bei manchen Honoratioren nicht gut an, sie waren noch verfangen im alten Denken und Dünkel und zum Teil auch sehr irritiert, dass plötzlich solche Bewegungen aus der Studentenschaft heraus auftreten.
Sehr bin ich übrigens von der Persönlichkeit Willy Brandts geprägt worden. Denken Sie an den berühmten Kniefall vor dem Ghetto-Denkmal in Warschau. Mit ihm kam endlich neue Bewegung in die Ost-West-Konfrontation hinein. Auch er brach alte verkrustete Strukturen auf und für mich und viele andere war klar, hier müssen wir tatkräftig mithelfen, und eine gute Möglichkeit ist gewesen, der SPD beizutreten. Anschließend bin ich einige Zeit kommunalpolitisch in Frechen tätig gewesen, aber mit den Versetzungen ging das natürlich nicht mehr.
WM: Nach dem Studium konnten Sie die Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie in Bergheim und Frechen abschließen. Was hat Sie bewogen, die Org/Fü Verwendung im Sanitätsdienst der Bundeswehr einer klinischen Laufbahn vorzuziehen?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Welchen Einfluss hatte diese Zeit nun auf meinen späteren Werdegang? Zunächst war ich noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt Medizin studieren werde oder zur Bundeswehr zurückgehe. Denn ich hatte ja Wehrdienst abgeleistet, dann auf drei Jahre verlängert und sozusagen eine gewisse Bodenhaftung bekommen. Schließlich habe ich mich dann entschlossen, Medizin zu studieren und zwar über die Möglichkeit eines Stipendiums der Bundeswehr. Ich durchlief die damals üblichen Auswahlkriterien, verpflichtete mich für 15 Jahre und erhielt nach nur einjähriger Tätigkeit als Truppenarzt die Möglichkeit einer Facharztweiterbildung in der Chirurgie. Dies ist für mich damals ein entscheidendes Kriterium gewesen, denn ich wollte mir dadurch gegenüber den Klinikern in der Bundeswehr eine gewisse Autorität verschaffen, um Akzeptanz zu erhalten und durchsetzungsfähig zu sein. Denn die Kliniker hielten damals eigentlich recht wenig von den sogenannten OrgFü-Leuten. 1978 bin ich mit der Facharztausbildung fertig gewesen. Obwohl mich der letzte Chefarzt fragte, ob ich nicht als Oberarzt bleiben wolle, habe ich mich doch wieder für die Bundeswehr entschieden und zwar nicht für den klinischen Bereich, sondern tatsächlich für OrgFü. Das lag auch darin begründet, dass in der Klinik doch sehr viel Routine und wenig eigener Spielraum herrschte. Man sah abends den Dienst- und OP-Plan des nächsten Tages und wusste dann schon ganz genau, wie der Tag abläuft ohne eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Ich suchte aber schon damals eine interessante Laufbahn, in der mit Versetzungen zu rechnen war, mit verschiedensten Verwendungen und mit Herausforderungen unterschiedlicher Art.
WM: Als Referatsleiter InSan II 1 haben Sie 1992 den Einsatz der Sanitätstruppe in Kambodscha geleitet, den ersten richtigen Auslandseinsatz der gesamten Bundeswehr. Was waren rückblickend gesehen damals die größten Herausforderungen für den deutschen Sanitätsdienst?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Auf den Sanitätsdienst der Bundeswehr kam erstmals in seiner Geschichte – relativ unverhofft – eine übergreifende Führungsrolle zu. Das war für alle Beteiligten schon sehr beeindruckend, denn selbst im BMVg ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus allen militärischen und zivilen Abteilungen zusammengestellt worden. Wir trafen uns fast täglich, und im Laufe der Zeit zeigte sich eine große Bereitschaft auch seitens der TSK und der zivilen Abteilungen, eine Führungsrolle des Sanitätsdienstes zu akzeptieren. Das Entscheidende war die reibungslose Durchführung dieses humanitären Auftrages, dieses für uns alle neuen Auftrages, der möglichst ohne Verwerfungen im eigenen Bereich bewältigt werden sollte. Daneben kristallisierte sich schnell während dieser ministeriellen Führungsaufgabe des Einsatzes rasch eine weitere eminent wichtige Aufgabe heraus, nämlich die der Fürsorge. Es galt auch die Bedürfnisse derjenigen anzusprechen und zu berücksichtigen, die wir in den Einsatz schicken wollten und vor allem auch ihrer Angehörigen. Heute ist das alles institutionalisiert, damals war es für uns Neuland: Die regelmäßige Unterrichtung der Familien über den Zustand der Truppe, die Gewährleistung von Telefon über Satellitenverbindungen, Versicherungsfragen, die nicht geregelt waren, die Frage einer Einsatzzulage. Wir führten Informationsveranstaltungen mit den Angehörigen des Kontingents an der SanAkBw ein, der Wehrbeauftragte, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sprachen, der gesamte Betreuungsaufwand, den wir ohne feststehende Organisation durchführten, war schon sehr umfassend. Und ich möchte betonen, dass alles sehr gut über die Bühne gegangen ist. Wir konnten demonstrieren, dass wir tatsächlich in der Lage waren, als Sanitätsdienst zu führen und nicht nur Dienstleistung zu erbringen für andere. Und das hat sich natürlich dann ausgezahlt, gegen Ende der 90er Jahre, als es um den Umbruch der Bundeswehr insgesamt ging. Jetzt konnten wir sozusagen aus dem Vollen heraus argumentieren.
WM: Unter Ihrer Ägide als Unterabteilungsleiter / Stv. InspSan ist die bis heute gültige Maxime des Sanitätsdienstes der Bundeswehr erlassen worden. Was waren damals die Einflussgrößen und welche Widerstände gab es? Wie sehen Sie heute diesen in vielen Auslandseinsätzen bewährten Leitsatz für die sanitätsdienstliche Versorgung von deutschen Soldaten im Auslandseinsatz vor dem Hintergrund neuer Einsatzoptionen im Rahmen der sogenannten Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Mit der großen Wende 1990, der Auflösung des Warschauer Vertrages und der Ost/West Annäherung dachten wir zunächst, es gibt überhaupt keine Einsätze mehr. Es ist jetzt Frieden. Man könnte im Grunde genommen die Bundeswehr, jedenfalls in ihrer damaligen bipolaren Aufstellung, auflösen. Dann kamen aber zunehmend Einsätze unter der Leitung der UNO, der NATO und anderer internationaler Organisationen auf uns zu. Wir mussten uns ein neues Einsatzkonzept überlegen, als Dienstleister Sanitätsdienst die Kräfte, die wir haben, bündeln, um auch vernünftig ausbilden zu können. Und vor allem dem jeweiligen Auslandskontingent maßgeschneidert die Anteile des Sanitätsdienstes zur Verfügung stellen, die tatsächlich notwendig für die Auftragserfüllung gewesen sind. Jeder unterschiedliche Einsatzauftrag bedurfte auch wieder unterschiedliche sanitätsdienstliche Gegebenheiten. Und die Bereitstellung solcher diversifizierter sanitätsdienstlicher Kräfte ist auch gut gelungen und hat dazu beigetragen, den Sanitätsdienst durch die Einsätze, durch dieses veränderte Bild einer überaus positiven Wahrnehmung im militärischen und politischen Bereich zuzuführen. Bei der Implementierung der fachlichen Leitlinie war unser Ansatz, Soldatinnen und Soldaten auch eines kleinen Kontingents gleich an welchem Einsatzort eine Garantie für eine Versorgungsqualität zu geben, die im Ergebnis der Behandlung dem Heimatstandard entspricht. Wir haben dies auch im Wehrmedizinischen Beirat ausführlich diskutiert, und auch der politische Raum hat dies sofort verstanden. So gelang es, mit unserer Maxime auch die Grundlage für Personalforderungen, Ausbildungsgänge und Beschaffungen zu legen. Mich hat in der letzten Zeit dieser Begriff der sogenannten „Refokussierung“ natürlich sehr bewegt, auch vor dem Hintergrund, ob die Leitlinie auch in einem Einsatz der Landesverteidigung mit seinem im Vergleich zu den bisherigen Auslandseinsätzen völlig anderen Einsatzprofil garantiert werden kann. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit meinen Überlegungen zu dieser Frage noch nicht am Ende bin. Natürlich ist es unbedingt erforderlich, das Prinzip der Maxime auch dann aufrecht zu erhalten, wenn es hier um eine flächendeckende Auseinandersetzung z. B. in Mitteleuropa, geht. Möglicherweise dadurch, dass man eine stärkere internationale Kooperation betreibt oder dass man Schwerpunkte bildet. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, eine Art drittklassiger Medizin auf dem potentiellen Schlachtfeld in der Fläche zu betreiben. Es ist tatsächlich ein Prozess, der für mich noch nicht richtig abgeschlossen ist und in seiner Tragweite auch nicht ganz übersehbar ist, weil mir natürlich auch die jeweiligen Truppenstärken oder auch die angenommenen Verwundetenraten nicht bekannt sind. Ich hoffe wirklich, dass es niemals in Europa zu solchen umfassenden Auseinandersetzungen kommen wird, die uns dann vielleicht zwingen, den gewohnten medizinischen Standard im militärischen, aber auch genauso im zivilen Bereich, nicht halten zu können. Das ist für mich eine fürchterliche Vorstellung.
WM: Sie haben sich in Ihrer aktiven Zeit als Inspekteur des Sanitätsdienstes sehr um die Verständigung mit dem russischen Sanitätsdienst bemüht. Ich erinnere mich einiger Zusammenkünfte mit dem damaligen Chef des russischen Sanitätsdienstes. Was empfinden Sie heute angesichts der Tatsache, dass die militärischen Strategien auch der NATO Staaten wieder von der Logik des Kalten Krieges geprägt zu sein scheinen?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Das ist eine sehr gute Frage, die mich beim Durchdenken wirklich sehr traurig stimmt. Es hat so verheißungsvoll angefangen mit unseren Kontakten. Mehrfach habe ich mich mit Generaloberst Dr. Tschich, dem damaligen Leiter des Sanitätsdienstes der Russischen Armee in Berlin oder Moskau, getroffen, auch in zwangloser Atmosphäre, in einem Sanatorium, in dessen Schwimmbad wir Wasserball zusammen gespielt haben. Man spürte geradezu eine gewisse Seelenverwandtschaft. Beide Seiten waren erleichtert, dass dieser unsägliche kalte Krieg aufgehört hat und wir versprachen uns für die Zukunft eine prosperierende Zusammenarbeit. Seit 1991 arbeiteten die NATO und Russland in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zusammen. 1994 wurde die Russische Föderation Mitglied im Programm „Partnerschaft für den Frieden“. Mit Unterzeichnung der „Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen Föderation“ vom Mai 1997 wurde die Kooperation darüber hinaus gefestigt und 2002 wurde der NATO-Russland-Rat gegründet. Wir gingen fest davon aus, dass das, was sich jetzt neu findet, auch Bestand haben wird. Und Sie können mir glauben, dass ich persönlich sehr betroffen gewesen bin, als plötzlich alle möglichen Brücken eingerissen wurden, die wir gebaut hatten. Aber ich bin immer noch der Ansicht, wenn man die Chancen nutzt, die sich auch jetzt noch z. B. in der Einsatzrealität gelegentlich ergeben können, nämlich dann auch noch zusammen zu arbeiten, wo hingegen sich das gesamte politische Wertgefüge verändert hat, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, Kontakte aufrecht zu erhalten. Was in Russland derzeit passiert, geschieht im Grunde genommen, um erstens die eigene Bevölkerung zusammen zu halten und zweitens eine geopolitische Macht wieder zu erlangen, die man vermeintlich aufgegeben oder geschmälert hat. Offensichtlich ist das Gefühl in der russischen Bevölkerung zunehmend verbreitet, dass man schwächer wird. Das hat Putin natürlich erkannt und auch nach innen wirkende Entschlüsse gefasst. Sein Auftreten zeugt davon, dass er imponieren will. Diese Entwicklung verträgt sich leider überhaupt nicht mit einem harmonischen Zusammenleben der Völker, gerade auch in Osteuropa.
WM: Welche Rolle könnte der Sanitätsdienst der Bundeswehr bei der Aufrechterhaltung eines Dialogs mit dem Sanitätsdienst Russlands leisten?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Das ist natürlich in Zeiten politischer Vernetzung, einer gemeinsam abgestimmten Russland-Politik des Westens nicht ganz einfach. Wie gesagt, ich hoffe, dass man gerade auf militärischer Seite Chancen nutzen kann, die sich durch die Kooperation in möglichen weiteren oder zukünftig gemeinsamen Auslandseinsätzen ergeben. Ansonsten müssen wir natürlich alle Chancen auf gemeinsame Gesprächsfäden nutzen, und seien sie noch so klein, wie z. B. auf dem CIMM-Kongress.
WM: Als Inspekteur des Sanitätsdienstes trugen Sie entscheidend zur Transformation des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr in einen eigenständigen Organisationsbereich bei. Diese Leistung stellt einen einzigartigen Schritt in der Geschichte deutscher Sanitätsdienste dar. Wen galt es damals mehr zu überzeugen: die politische Führung, die Teilstreitkräfte oder die eigenen Truppen?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Ein leichter Prozess ist das bestimmt nicht gewesen. Interessanterweise mussten wir uns den Rückhalt bei der eigenen Truppe im Sanitätsdienst durchaus hart erarbeiten, obwohl damals in der Vergangenheit immer wieder mehr Eigenständigkeit eingefordert worden war. Beispielsweise hatte Prof. Dr. Rebentisch schon früh einen auf das Heer bezogenen zusammengefassten Sanitätsdienst im Sinn. Als dann plötzlich die Möglichkeit eines eigenen Organisationsbereiches bestand, waren viele höhere Sanitätsoffiziere anfangs etwas zögerlich, in dem Sinne, dass es doch wohl einfacher sein, im Hintergrund fachliche Empfehlungen zu geben, als tatsächlich zu entscheiden und Führungsverantwortung wahrzunehmen. Im Gegensatz dazu waren die Teilstreitkräfte relativ einfach durch die Argumente der auf jeden Fall gesicherten und sogar qualitätsgesteigerten truppenärztlichen Versorgung und der Bedarfsdeckung im Übungs- und Einsatzfall zu überzeugen. Es war für mich erstaunlich, dass es sogar von den Inspekteuren der TSK ein großes Entgegenkommen gab, auf eigene integrierte Sanitätsbestandteile zu verzichten und sie in die Zentralisierung zu überführen, weil sie sich damit auch eine besser zu organisierende Sanitätsausbildung versprachen. Großen Verdienst an dieser positiven Entwicklung hatte damals das Heer. In vielen Gesprächen mit dem Inspekteur, General Willmann, konnte ich hier Verständnis und aktive Unterstützung gewinnen, auf die eigenen Truppenärzte zu verzichten und eine regionale Zusammenfassung zu favorisieren. Die Inspekteure der Luftwaffe und Marine beharrten allerdings auf ihren beiden Untersuchungs- und Forschungsinstituten, den Flieger- und Schiffsärzten, so dass schließlich auch im Heer durch die Sanitätsversorgung der Spezialkräfte eine gewisse integrierte Insellösung verblieb, mit der alle leben konnten.
Die dritte Größe, die bei der Umstrukturierung des Sanitätsdienstes eine ganz wichtige Rolle einnahm, war natürlich der politische Bereich. Und tatsächlich erhielt ich hier rückblickend gesehen die am leichtesten zu erreichende und wirksamste Unterstützung. Ich ging bei den Abgeordneten aller Parteien sehr argumentativ vor, so dass ich schnell die parteienübergreifende notwendige politische Unterstützung erhalten habe, verbunden mit der Unterstützung für Personal-, Investitions- und Beschaffungsaufgaben. Und auch der Verteidigungsminister Scharping sah im Verteidigungsausschuss überhaupt keine Probleme, unseren Vorschlägen zuzustimmen.
WM: Nicht erreicht werden konnte eine eigene Uniform für die Angehörigen des Sanitätsdienstes. Sie haben deshalb den Kragenstecker eingeführt, der bei Uniformträgern aller Teilstreitkräfte die Zugehörigkeit zum Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr kennzeichnete. Mittlerweile ist dieses Symbol wieder abgeschafft worden. Halten Sie aus heutiger Sicht eine eigene Uniform weiter für sinnvoll oder hat sich das Problem eher über die Zeit gegeben?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Ja, der alte Kragenstecker. Tatsächlich bin ich von Anfang an nicht ganz überzeugt gewesen von diesem Symbol des Zentralen Sanitätsdienstes, allein schon aus pragmatischen Gesichtspunkten, weil letzten Endes die Krägen von den Nadeln des Steckers ruiniert wurden. Aber viele unserer Soldaten wünschten sich eine gewisse Einheitlichkeit in der Erscheinungsform. Die einheitliche Uniform war natürlich eine Vision. Und unter anderem auch bedingt durch die Vorgehensweise des französischen Sanitätsdienstes, der eine einheitliche dunkelblaue durchaus sehr ansehnliche Uniform zugestanden bekam. Auch ich hatte mir schon vorgestellt, man könnte so etwas auf der Basis der Marine-Uniformjacke mit Schulterklappen auch für uns generieren. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt mit unserer Zentralisierung aber schon so viel erreicht, dass ich mir gedacht habe, wenn du jetzt auch noch damit kommst, wird die Geduld oder das Entgegenkommen auch der TSK vielleicht überbeansprucht. Wir hatten ja immer auch Sanitätspersonal in den TSK, welche Art Uniform sollten die dann tragen? Unsere neuen oder doch die TSK-spezifischen? Hinzu kamen auch noch einige fiskalische Probleme mit der Finanzierbarkeit einer neuen Uniform. Heute habe ich den Eindruck, spielt das keine große Rolle mehr, auch wenn ich persönlich es besser fände, wenn z. B. bei den Fallschirmjägern auch der Sanitätsdienst unser blaues Barett tragen würde.
WM: Den Beginn der großen Zeitenwende, die Ereignisse des 11. September 2001, haben Sie am Fernsehschirm in Ihrem Dienstzimmer verfolgt. Ist Ihnen die Bedeutung dieses Tages damals sofort bewusst gewesen?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Nein, eigentlich nicht. Ich habe in dem Moment am Fernsehgerät in meinem Dienstzimmer auf der Hardthöhe gedacht, ein fürchterliches Ereignis aus einer anderen Welt, das sich da auf dem Bildschirm abspielt und im Grunde jede Vorstellungskraft sprengt. Das wird man aufarbeiten müssen und versuchen müssen, dass sich so etwas nie wiederholt. Aber die praktischen Folgerungen politischer und militärischer Art, die sich daraus ergeben haben, auch was das Verhalten der US-amerikanischen Administration angeht, die waren für mich nicht voraussehbar. Mich hat das so überwältigt, dass ich wohl zu klarerem Denken, zur Ableitung logischerer Konsequenzen am Anfang gar nicht in der Lage gewesen bin.
WM: Im gleichen Jahr 2001 begann der Einsatz in Afghanistan. Er hat zahlreichen – auch deutschen Soldaten – das Leben gekostet, dauert bis heute an, ohne dass grundlegende Fortschritte zu erkennen wären. Wie empfinden Sie diesen Einsatz heute? Was könnte man anders, besser machen?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Wir haben uns damals aus politischen Gründen an dem ISAF-Einsatz beteiligt, unter der Vorstellung, wir führen unter der Ägide der NATO als Zeichen der Bündnissolidarität einen humanitären Einsatz zur Unterstützung der afghanischen Bevölkerung durch, die über Jahre von den Taliban drangsaliert worden ist. Diese erste Periode des Einsatzes am Hindukusch habe ich noch in meiner aktiven Zeit sanitätsdienstlich gestaltet. Die Entwicklung der folgenden Jahre war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Rückblickend sehe ich es als großes Defizit an, dass dieser Einsatz Jahr für Jahr, nunmehr tatsächlich 17 Jahre lang durch das Parlament verlängert wird, ohne dass jemals eine klare Zielsetzung definiert worden ist. Was hat dieser Einsatz uns, was hat dieser Einsatz alle beteiligten Nationen seither an Ressourcen gekostet, von den ganzen menschlichen Tragödien zu schweigen?
Daher plädiere ich heute entschieden dafür, dass man vor der Beteiligung an künftigen Einsätzen nicht nur die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit des Engagements nachweisen sollte, sondern auch über die Einsatzdauer zu reden hat, sozusagen die „Exit Strategy“ festzulegen ist.
WM: Nach Ihrer Versetzung in den Ruhestand 2003 sind Sie Bundesarzt im Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes geworden. Welche Aufgaben hatten Sie in dieser Funktion?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Auch in der Vergangenheit wurden ausgeschiedene Inspekteure des Sanitätsdienstes der Bundeswehr immer wieder vom Deutschen Roten Kreuz gebeten, die Position des Bundesarztes des DRK zu übernehmen. Das DRK beabsichtigte damit, auch nach außen deutlich zu machen, dass in seinen Aufgaben und Zielsetzungen bei allen völkerrechtlichen Spezifizierungen eine Nähe und Verbundenheit zum Sanitätsdienst der Bundeswehr bestand. Nach meiner Zusage stellte sich schnell heraus, dass die Hauptaufgabe darin bestand, die jeweiligen Landesverbände mit ihren jeweiligen Landesärzten organisatorisch und koordinativ zu beraten und Ausbildungs- wie Einsatzgrundsätze zu vereinheitlichen. Es war für mich am Anfang doch überraschend zu erkennen, dass im DRK der Sanitätsdienst nicht unbedingt eine umfassende medizinische Versorgung bedeutet, sondern dass damit oft auch die Unterstützung von Großveranstaltungen durch freiwilliges Hilfspersonal gemeint ist. Die besondere Bedeutung von Standardisierungskonzepten, wie z. B. der Vereinheitlichung von Maßnahmen der Ersten Hilfe, liegt somit auf der Hand, und darin habe ich auch meine Hauptaufgabe in den beiden Amtsperioden von jeweils 3 Jahren bis zum Frühjahr 2009 gesehen. Mein Nachfolger ist übrigens auch dank meiner Unterstützung der bekannte Notfall- und Intensivmediziner Prof. Dr. Peter Sefrin geworden. Er war ursprünglich Landesarzt im Bayerischen Roten Kreuz. Als ehemaliger Uniformträger und Verantwortlicher für den Sanitätsdienst der Bundeswehr bin ich in diesem Zusammenhang vom Präsidenten des DRK, Dr. Rudolf Seiters, gebeten worden, das neu eingerichtete Amt des Beauftragten für zivil-militärische Zusammenarbeit im DRK zu übernehmen. Das bedeutete für mich weitere Amtsperioden bis zum Jahr 2017.
WM: Wie bewerten Sie das Verhältnis zwischen dem Sanitätsdienst der Bundeswehr und dem Deutschen Roten Kreuz? Welche weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit könnte es heute geben?
GOStA a. D. Dr. Demmer: In meiner ganzen Zeit als aktiver Sanitätsoffizier habe ich in Bezug auf das gegenseitige Verhältnis zwischen Sanitätsdienst und DRK festgestellt, dass es immer gewisse Vorbehalte gegenüber der jeweiligen anderen Seite gegeben hat. Beim Roten Kreuz wurde stets auch nach außen intensiv um die Grundsätze der Unabhängigkeit und Neutralität bei der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr diskutiert und zuweilen die Frage gestellt, ob der Sanitätsdienst der Bundeswehr nicht doch nur seine eigenen Soldaten versorgt und seinen humanitären Verpflichtungen und Bindungen, die sich in einem Einsatz ergeben können, wirklich nachkommt. Natürlich sind wir dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, das ist ja unser umfassender Versorgungsgrundsatz. Und auf der militärischen Seite wurde beim DRK zuweilen unterstellt, dass es gar keine Nähe zum Sanitätsdienst möchte, weil wir eben zu unterschiedlich wären. Das ist im Laufe der Zeit überwunden worden. Der gemeinsame Ebola-Einsatz hat geholfen, viele Widerstände abzubauen und Brücken zu errichten. Und 2015 ist zum ersten Mal in der Geschichte von Deutschem Roten Kreuz und Bundeswehr am Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr in Nienburg eine Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Institutionen geschlossen worden. Historisch für die erstmalige vertragsgebundene Zusammenarbeit und richtungsweisend in die Zukunft kann seither in realen Szenarien, im Friedensbetrieb als auch unter Einsatzbedingungen zusammengearbeitet werden. Beide Organisationen betreiben künftig Netzwerk-Arbeit im Sinne der Zielsetzung zur Verbesserung der Einsatz-Maßnahmen. Neu und besonders bedeutsam ist die Verankerung des DRK-Verbindungsbüros als erstes ziviles Verbindungselement in die militärische Struktur des Zentrum ZMZ in Nienburg.
WM: Im Herbst 2013 sind Sie Vorsitzender des Förderkreises „Darmstädter Signal“ geworden. Der Arbeitskreis ist ein Zusammenschluss aktiver und ehemaliger Soldaten der Bundeswehr, die sich der Friedensbewegung verbunden fühlen und die offizielle Politik in und um die Bundeswehr kritisch verfolgen. Wie stehen Sie heute zu den politischen Rahmenbedingungen, in der die Bundeswehr agieren muss?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Ich bin schon in den 1980ziger Jahren im Zuge der Nachrüstungsdebatte und der Rüstungsspirale in den Förderkreis des Arbeitskreises Darmstädter Signals eingetreten, auch weil mir damals manche martialische Äußerung aus dem politischen Bereich nicht gefallen hat. Später, nachdem der damalige Vorsitzende gestorben war, bin ich dann dort Nachfolger geworden. Der Förderkreis hat die Aufgabe, den eigentlichen Arbeitskreis zu beobachten und zu beraten. Es ging für mich und meine Mitstreiter immer darum, die Innere Führung als entscheidende Grundlage für das Miteinander in der Bundeswehr zu platzieren und zu leben. Es gilt, den gegenseitigen Respekt von Vorgesetzten zu Untergebenen in jedem Fall aufrecht zu halten. Wir konnten in diesem Zusammenhang mithelfen, etliche Streitfälle zu schlichten. Heute setzt sich der Arbeitskreis vornehmlich mit der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr auseinander. Und stellt auch die kritischen Fragen: Warum müssen wir uns bei Einsätzen beteiligen? Was hat das eigentlich mit unserem ursprünglichen Auftrag der Landesverteidigung zu tun? Denken Sie an den rechtswidrig begonnenen Irak-Krieg, das hat man damals offiziell anders gesehen. Aber der Arbeitskreis wies bereits zu Beginn dieses Krieges in zugespitzter Form auf diese Völkerrechtswidrigkeit hin. Heute versuchen die Mitglieder des Arbeitskreises im besten Sinne als Staatsbürger in Uniform durch Informationsveranstaltungen, Vorträge, interne und öffentliche Diskussionen, Missstände in der Bundeswehr zu kritisieren und Alternativvorschläge zu erarbeiten. Und vor allem sollen Auslandseinsätze eben nur nach dem Scheitern aller friedlichen Konfliktlösungsversuche durch UN-mandatierte Einsätze möglich sein.
WM: Eine letzte Frage: Rückblickend gesehen: Gibt es ein besonderes Ereignis, einen Moment in Ihrer aktiven Dienstzeit, der Sie noch heute intensiv beschäftigt?
GOStA a. D. Dr. Demmer: Was die dienstlichen Abläufe angeht, hat mich tatsächlich relativ wenig innerlich erschüttert. Weil im Grunde genommen alles, was wir anpackten, doch unter einem positiven Stern ablief. Es wurde erreicht, was wir erreichen wollten. Aber ich erinnere mich an ein Ereignis am Anfang meiner Dienstzeit. Das war noch vor dem Studium. Ich war damals bei der Fernmeldetruppe: Die Kuba-Krise 1961. Diese Tage waren für die Zeitgenossen derart aufregend und stecken mir heute immer noch in den Knochen, weil jeder dachte, es gibt jetzt unausweichlich, fast unausweichlich Krieg. Die russischen Schiffe mit ihren Raketen liefen auf Kuba zu, die Amerikaner hatten eine unversöhnliche Haltung und wir standen kurz vor einem Kulminationspunkt, vielleicht sogar dem Atomkrieg. In diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote: Als die Russen auf Kuba zuliefen, verschickte unser Kompaniechef an uns Soldaten Telegramme, Alarmbereitschaft sei angeordnet und wir müssten sofort von zu Hause in die Kaserne kommen. Der Mann hatte den Namen „Krieg“ und damit hat er das Telegramm unterzeichnet. Sie können sich vorstellen, was zu Hause in der Familie los war.
Gott sei Dank lief im Hintergrund einiges an Diplomatie und plötzlich drehten die russischen Schiffe bei. Das steckt mir noch heute in den Knochen und ich hatte damals gedacht, wenn es jetzt keinen Krieg gibt, es war ja die Hochzeit des Kalten Krieges, wenn es jetzt nicht kracht, dann gibt es überhaupt keinen Krieg mehr. Das dachte ich so. Wie man sich wohl täuschen kann. Immer noch gibt es Kriege und man hat fast den Eindruck, solche Konflikte entsprechen einem Grundbedürfnis bestimmter Gruppierungen in den Gesellschaften aller Staaten. Dabei ist das Entscheidende nicht die Auseinandersetzung, sondern doch die Versöhnung.
Herr Generaloberstabsarzt Dr. Demmer, haben Sie vielen Dank für dieses bemerkenswerte Zeitzeugengespräch, für Ihre persönlichen Eindrücke und Ihre Offenheit auch in schwierigen Fragen.
Flottenarzt Dr. Hartmann
Chefredakteur WM
Datum: 17.06.2019
Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2019