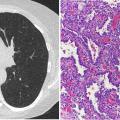„Der Menschlichkeit verpflichtet!“ – Gedanken zum Leitspruch des SanDstBw –
Am 22. November 2017 wurde im Rahmen einer Feierstunde die Lehr- und Forschungsstelle für Wehrmedizinische Ethik (LFWME) an der Sanitätsakademie der Bundeswehr durch die Kommandeurin der SanAkBw, Frau Generalstabsarzt Dr. Gesine Krüger, offiziell eröffnet. Der Leiter der Forschungsstelle, Oberfeldarzt d. R. Dr. Dr. Rupert Fischer, hielt den nachstehend in Auszügen abgedruckten Festvortrag.
Der Leitspruch des Sanitätsdienstes „Der Menschlichkeit verpflichtet!“
„Der Menschlichkeit verpflichtet!“ – so lautet der Leitspruch des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Seine Wahl lässt aufhorchen, nicht zuletzt in einem militärischen Kontext. Wenn sich der Sanitätsdienst der Bundeswehr diesen Spruch auf die Fahne schreibt, lässt er sich in die Pflicht nehmen. Nichts weniger als die Menschlichkeit soll oberste Richtschnur sanitätsdienstlichen Handelns sein.
Der zentrale Stellenwert, der dem Leitspruch „Der Menschlichkeit verpflichtet!“ beigemessen wird, kommt nicht zuletzt in seiner öffentlichkeitswirksamen Verwendung als Logo des Sanitätsdienstes zum Ausdruck. Als solches findet sich der Schriftzug auf allen offiziellen Dokumenten, Briefen, Flyern und Plakaten in markanter Form mit hohem Wiedererkennungswert.
Der Leitspruch besitzt eine maßgebliche Relevanz, wenn es darum geht, Selbstverständnis, Handlungskonzept, Wertesystem und Organisationskultur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr näher zu bestimmen. Der Versuch einer Erhellung des Leitspruches lädt dazu ein, über das Phänomen der Menschlichkeit nachzudenken. Indem wir dies tun, bergen wir den Sinn dieses Diktums „Der Menschlichkeit verpflichtet!“ in unsere konkrete Lebenswirklichkeit. Was ist damit gemeint? Es bedeutet, den Leitspruch des Sanitätsdienstes nicht als abstrakten, aber letztlich dem Leben fernstehenden Gedanken zu begreifen, sondern ihn als das zu verstehen, was er ist: identitätsstiftende Richtschnur zum Handeln.
„Der Menschlichkeit verpflichtet!“ – dieses Wort, das so gefällig als Logo des Sanitätsdienstes daherkommt, erweist sich also als höchst anspruchsvoll; keinesfalls darf es zu einer bedeutungslosen Worthülse verkommen. Ganz bewusst wurde dieser Spruch von der Leitung des Sanitätsdienstes seinerzeit im Anschluss an einen Prozess gewählt, in dem die Frage nach dem Waffeneinsatz durch Sanitätspersonal geklärt werden sollte. Indem die Verpflichtung zur Menschlichkeit als zentrale Richtlinie sanitätsdienstlichen Handelns bestimmt wird, kommt eine den Sanitätsdienst im Gesamt der Bundeswehr besonders prägende Wertigkeit zum Ausdruck. Nicht der Waffengebrauch, so unerlässlich er bisweilen auch zur Absicherung sanitätsdienstlichen Handelns sein mag, steht im Focus, sondern der Dienst vom Menschen am Menschen.Sanitätsdienstliche Ausbildung wird neben den vielfältigen Kompetenzen, die es hier zu vermitteln gilt, der Frage nach der Bedeutung, die der Leitspruch „Der Menschlichkeit verpflichtet!“ für den Einzelnen wie für den Sanitätsdienst und die Bundeswehr insgesamt hat, einen entsprechenden Raum einzuräumen haben. Diesem Sachverhalt muss sanitätsdienstliche Ausbildung Rechnung tragen, das heißt sie muss Zeiten und Räume freilassen, in denen sich junge Menschen mit Fragen nach dem Sinnhorizont sanitätsdienstlichen Wirkens befassen können.
Die Gefährdung der Humanitas im asymmetrischen Konflikt
Seit jeher konfrontiert der Krieg den Menschen in besonderer Weise mit der Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein. Während in Friedenszeiten diese Frage zumeist nicht zum Thema wird, ändert sich dies in entscheidendem Maße in Zeiten des Krieges. Der Krieg stellt eine singuläre Herausforderung für den Menschen dar, birgt er doch zugleich die Gefahr der Grausamkeit und die Chance der Menschlichkeit. Sowohl die Manifestation der Grausamkeit als auch die der Menschlichkeit geht auf den Menschen selbst zurück. Der Krieg als menschliches Phänomen hat einen paradoxalen Charakter. Hierin unterscheidet sich gerade dieser beispielsweise von Naturkatastrophen, denn die Grausamkeiten des Krieges sind menschenverschuldet.
Grausamkeit und Menschlichkeit – zu beiden ist der Mensch fähig. Hier zeigt sich die Tiefe, in die der Mensch sinken kann, neben der Höhe des Menschseins, zu der er berufen ist. Gerade dieses Menschsein aber erweist sich als gefährdet. Krieg ist immer mehr als ein Kampf um Leben und Tod. Hier steht immer mehr auf dem Spiel und ich zögere nicht zu behaupten, alle Kriege der Menschheit legen Zeugnis dafür ab, dass der Mensch sich in seinem Menschsein zu verfehlen vermag.
Die Geschichte der Menschheit kennt unzählige Beispiele dafür. Gerade wir in Deutschland haben hier eine besondere Verantwortung: Aus der Erfahrung zweier Weltkriege und besonders des Holocaust erwächst die Pflicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden, indem wir achtsam sind gegenüber den Grausamkeiten in der Welt und indem wir uns der Menschlichkeit verpflichten. Der Frage nach der Menschlichkeit und ihrer Gefährdung durch die Grausamkeiten, die Menschen einander anzutun in der Lage sind, erhält in unseren Tagen besonderes Gewicht durch die sogenannten Neuen Kriege.
Es war nicht zuletzt diese Entwicklung und die Frage, wie hierauf zu reagieren sei, die Ende der 1990er Jahre zur Herausbildung einer eigenständigen Bereichsethik führte, die medizinethische Fragen im militärischen Kontext aufgriff. Dabei ist die grundsätzliche Thematik nicht neu. Bereits die erste deutschsprachige Monographie zur Medizinethik von Albert Moll (1862 - 1939) aus dem Jahr 1902 kommt hierauf zu sprechen.
Humanitas als philosophische Frage
Ohne jeden Zweifel zählen die Berichte Henri Dunants (1828 - 1910) und Florence Nightingales (1820 - 1910) zu den wichtigsten Erfahrungsberichten, die im Namen der Menschlichkeit verfasst wurden. Bei der wehrmedizinethischen Erhellung der Humanitas kommt ihnen bis heute eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Die hierbei aufgeworfene Frage nach dem Wesen des Menschen ist freilich älter. Sie reicht zurück bis in die griechische Antike. Humanitas als philosophische Frage veranlasste zu immer neuen Versuchen, das Wesen des Menschen im Kern zu erfassen. Auch wenn eine abschließende Antwort hier wohl kaum zu geben sein wird, bedeutet dies nicht, dass sich die Frage ignorieren lässt. Vielmehr gilt es, ihr in konkreten Lebenssituationen nachzuspüren und vor deren Hintergrund eine persönliche Antwort auf die Frage „Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?“ zu geben.
Nur am Rande möchte ich Sie auf einige grundlegende Ansätze in der Philosophie hinweisen. Die deutsch-amerikanische Philosophin Hannah Arendt (1906 - 1975) betonte die Freundschaft als fundamentales Charakteristikum der Humanitas. Diese Idee der Freundschaft ist eng verbunden mit der Idee der Brüderlichkeit, wie es bereits im Motto „Tutti fratelli“ zu Zeiten Henri Dunants anklang. Gerade hierfür stand auch der französische Philosoph Gabriel Marcel (1889 - 1973).
Beide – Freundschaft und Brüderlichkeit – gründen in einem Phänomen, das die philosophische Tradition als Menschenliebe oder Menschenfreundlichkeit bezeichnet. Sehr eindrucksvoll kommt diese in einem Wort des Italieners Claudio Aquaviva (1543 - 1615) zum Ausdruck: „Fortíter in re, suáviter in modo“[¹] – ein Satz, den ich mit „Klar, tapfer, entschieden in der Sache, freundlich im Umgang“ übersetzen würde.
Egal ob wir das Phänomen der Humanitas auf Freundschaft oder Brüderlichkeit gründen lassen, beide haben ihren Ursprung in der Menschenfreundlichkeit. Diese bewirkt ein respektvolles Sich-Öffnen gegenüber dem Anderen. Ohne Zweifel dieses Sich-Öffnen ist (gerade im Krieg) eine sehr fragile Angelegenheit, die vor allem auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Dieses stellt zumindest im Hinblick auf den Umgang mit Verwundeten und Verletzten die Basis des Humanitären Völkerrechtes dar. Ich will mich nicht der Illusion hingeben, dass es im Alltag stets diese auf Menschenfreundlichkeit basierende Idee einer alle Menschen einenden Freundschaft oder Brüderlichkeit gewesen ist, die zur Einhaltung der Genfer Konvention Anlass gab. Vielleicht war es nicht selten die Sorge, vom Rest der Welt verachtet zu werden; vielleicht nur der Gedanke des „do ut des“ („Ich gebe, damit du gibst.“), des wechselseitigen Gebens und Nehmens. Auch, wenn diese Idee sich weniger altruistischen Überlegungen als vielmehr einer Nützlichkeitserwägung verdankt, so gaben diese Motive dennoch ein Fundament ab, das sich für die symmetrischen Konflikte vergangener Zeiten als mehr oder weniger tragfähig erwies. Wird dieser Minimalkonsens jedoch aufgegeben, stehen wir an der Schwelle zur Grausamkeit.
Humanitas als medizinische Frage
Über die Bedeutung der Menschlichkeit nachzudenken, ist dabei weit mehr als eine Aufgabe, die einer philosophischen Spekulation überlassen werden kann. Die praktische Relevanz erwies und erweist sich bis auf den heutigen Tag für unzählige Menschen als im wahrsten Sinne des Wortes lebenserhaltend. Sie nimmt nicht zuletzt einen zentralen Platz im Selbstverständnis des sanitätsdienstlichen Fachpersonals ein. Ich wage zu behaupten, dass sie die zentrale Frage schlechthin ist, an der sich entscheidet, was Medizin im Letzten bedeutet. Auf ihr basiert alle medizinische Forschung, Lehre und Behandlung.
Leider waren es auch deutsche Ärztinnen und Ärzte, die im Rahmen der nationalsozialistischen Medizin zeigten, welch grauenhafte Formen medizinische Forschung annimmt, wenn Patienten nicht mehr als Menschen, sondern nur noch als Versuchsmaterial angesehen werden. Beispielhaft möchte ich in diesem Zusammenhang an den Nürnberger Ärzteprozess der Jahre 1946 und 1947 erinnern. Die bisweilen schwer zu ertragenden Dokumente des Verfahrens hat seinerzeit Alexander Mitscherlich (1908 - 1982) in seinem Werk Medizin ohne Menschlichkeit zusammengetragen.
Auch möchte ich auf ein Problem unserer Tage hinweisen, das zeigt, wie sich (Militär)Ärzte moralisch kompromittieren können: die Verstrickungen von Ärzten unter der Bush-Administration in als spezielle Verhörmethoden bezeichnete Foltermaßnahmen. Steven Mills hat sich in seiner Monographie Oath betrayed aus dem Jahr 2006 eingehend mit dieser dunklen Seite ärztlichen Handelns beschäftigt.
Die Frage nach der moralischen Kompromittierbarkeit des Menschen muss also nicht nur im Anschluss an die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus neu gestellt werden. Moralpsychologisch wurde sie vor allem im Rahmen des 1961 durchgeführten Milgram-Experiments und des 1971 erfolgten Stanford Prison Experiments angegangen.
Weltweit führten die Grausamkeiten der NS-Medizin in der Folgezeit zu einer Neuausrichtung ärztlichen Handelns. Ein Zeugnis hierfür ist bis heute die Genfer Deklaration der World Medical Association aus dem Jahr 1948, die bereits in ihrem ersten Satz auf die Menschlichkeit zu sprechen kommt: „At the time of being admitted as a member of the medical profession: I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity.“[²]
Die Bundesärztekammer hat das Genfer Ärztegelöbnis in die Präambel zur Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte aufgenommen.[³] Weit davon entfernt, Lösungen für konkrete medizinethische Fragen unserer Tage zu geben, mahnt das Genfer Gelöbnis zur immer neuerlichen Beschäftigung mit der Frage, was es überhaupt bedeutet, Arzt oder Ärztin zu sein. Allgemeiner ließe sich in unserem Kontext fragen: Was bedeutet es, dem Sanitätsdienst der Bundeswehr anzugehören?
Auf diese Frage hat sich der Sanitätsdienst selbst eine Antwort gegeben, indem er sich den Leitspruch „Der Menschlichkeit verpflichtet!“ gab und darüber hinaus sein Selbstverständnis und Leitbild ausarbeitete. Freilich kann dies nur das Fundament einer konstruktiv-kritischen Auseinandersetzung mit medizinethischen Fragen im Sanitätsdienst der Bundeswehr darstellen. Es bedarf darüber hinaus großer Anstrengungen in Forschung und Lehre. Hierzu wurde an der Sanitätsakademie der Bundeswehr durch die Verankerung wehrmedizinethischer Unterrichtseinheiten in verschiedenen Lehrgängen ein bedeutender Anfang gesetzt. Auch die Einrichtung der Lehr- und Forschungsstelle für wehrmedizinische Ethik zeugt hiervon.
Das Ideal des philosophisch gebildeten Arztes
Im Jahr 1798 betont der deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724 - 1804) in seiner Schrift Der Streit der Fakultäten die besondere fachliche Nähe der Medizin zur Philosophie.[⁴] Dies mag heutzutage nicht wenige überraschen, wird doch der naturwissenschaftlichen Reflexion innerhalb der Medizin gemeinhin ein erheblich größeres Gewicht beigemessen als der geisteswissenschaftlichen. Tatsächlich schaut die enge Verbindung von Philosophie und Medizin auf eine lange Tradition zurück. Bereits das Corpus hippocraticum betont die Bedeutung philosophisch geschulter Ärzte („Ein Arzt, der die Weisheit liebt, ist gottgleich.“)[⁵].
Es lassen sich eine Reihe von Gründen aufzeigen, die seit dem 17. Jahrhundert zur Preisgabe des Ideals eines philosophisch geschulten Arztes („philosophically trained medical doctor“) führten. Ein zunehmend naturwissenschaftliches Selbstverständnis zeigt sich beispielsweise in einem Zitat des deutschen Pathologen Bernhard Naunyn (1839 - 1925) aus dem Jahr 1900: „Die Medizin wird eine (Natur-)Wissenschaft oder sie wird nicht sein.“[⁶] Ohne die Bedeutung naturwissenschaftlichen Denkens für die Errungenschaften in Diagnostik und Therapie in Abrede zu stellen, erscheint es fragwürdig, ob die Medizin allein auf einem naturwissenschaftlichen Selbstverständnis gründen kann. Medizin basiert stets auch auf philosophischen Überlegungen. Und auch dies zeigt eindrücklich ein Zitat Naunyns: „Da die Mediziner es aber mit Menschen zu tun haben, setzen uns Humanität und Pietät enge Grenzen.“[⁷] Die Arzt-Patienten-Beziehung und die diese in besonderer Weise bestimmende Erfahrung von Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod oder auch Wohlbefinden und Leid bedarf einer die Medizin als Naturwissenschaft transzendierenden Perspektive, da sich keiner dieser Begriffe naturwissenschaftlich zufriedenstellend definieren lässt.
Die Idee des philosophisch geschulten Arztes erscheint gerade heute in vielerlei Hinsicht ein erstrebenswertes Ideal. Bitte verstehen Sie mich richtig: Keinesfalls möchte ich hiermit fordern, dass die Angehörigen eines Approbationsberufes (seien es nun Ärzte, Zahnärzte oder Apotheker) professionelle Philosophen werden sollen. Dennoch sind grundlegende Fachkenntnisse in Philosophie und hier insbesondere in Militär- und Medizinethik von erheblicher Bedeutung, wenn es darum geht, moralische Fachentscheidungen zu treffen.
Moral Fitness
Ethische Kompetenzvermittlung im Allgemeinen und militär- bzw. wehrmedizinethische Kompetenzvermittlung im Speziellen gewinnen nicht zuletzt vor dem Hintergrund sogenannter Doppelter-Loyalitäts-Konflikte eine erhebliche Relevanz. Die Zweifachverwendung als Sanitäter und Soldat birgt in vielfacher Hinsicht Konfliktpotenzial, so zum Beispiel der Waffengebrauch durch Sanitätspersonal, die Versorgung der Zivilbevölkerung im Einsatzland oder aber die international sehr kontrovers diskutierte Frage nach Arzt und Folter.
Diese wehrmedizinethischen Problemfelder zeigen deutlich, dass es einer Kompetenz bedarf, um auf entsprechende Herausforderungen adäquat reagieren zu können. In Anlehnung an das Comprehensive Soldier Fitness Modell der US-Army, das neben der körperlichen und mentalen Fitness eine Reihe weiterer Bereiche benennt, die für eine gelingende Einsatzbewältigung von Bedeutung sind, schlage ich ein dreigliedriges Modell vor, das neben der körperlichen und mentalen auch eine moralische Fitness ausweist. Für den Sanitätsdienst schließt diese nicht nur eine militärethische, sondern vor allem auch eine wehrmedizinethische Kompetenz mit ein.
Zu den zentralen Ausbildungszielen, die eine wehrmedizinethische Lehre zur Vermittlung einer Moral Fitness beitragen sollte zählen:
- Das Verständnis für die Bedeutung medizinethischer Fragen und die Bereitschaft, sich hiermit zu beschäftigen
- Das Wissen um spezielle moralische Entscheidungssituationen (Doppelte-Loyalitäts-Konflikte)
- Die Kenntnis der zentralen medizinethischen Referenztexte
- Die Moral-Injury-Prävention
- Eintreten für ärztliche Werte auch in militärischen Konflikten (Bekenntnis zum „waffenlosen Dienst“ und gegen Folter).
Humanitas als Paradigma der Wehrmedizinethik
Die Fragen „Was für ein Arzt bin ich?“ oder „Was für ein Soldat bin ich?“ – sie wollen einmal im Leben gestellt und beantwortet sein. Die grundlegendste aller Fragen, die einem jedem Menschen aufgegeben ist, aber lautet: „Was für ein Mensch bin ich?“.
Diese Fragen verweisen auf den Fragenden selbst. Ihre konkrete Antwort jedoch finden sie im Umgang mit dem Anderen. In der Begegnung des Menschen mit Menschen entscheidet sich sein Menschsein. Ethisches Fragen trägt deshalb stets auch dialogphilosophische Züge. Es bezieht sich auf den Menschen als relationale Existenz, die nur in der gelingenden Beziehung zum Anderen zur Fülle gelangt. Der Ort, an dem sich mein Menschsein realisiert, aber ist Prüfstein der Menschlichkeit. Menschlichkeit meint Anruf und Antwort, Bereitschaft zum Dialog, Fähigkeit, im Anderen ein Du zu erkennen, Abwehr der Tendenz, dieses Du zu einem Es zu degradieren. Das im Hinblick auf Dunant und Nightingale betonte Phänomen der Menschlichkeit, welches im Hören auf die Schreie der Verwundeten eine einschlägige Formulierung fand, will auch heute bedacht sein. Niemals bin ich mehr Mensch, als wenn ich ganz beim Menschen bin. Dieser Wahrheit trägt das Prinzip „Der Menschlichkeit verpflichtet!“ Rechnung.
Dr. med. Dr. theol. Rupert Dirk Fischer, Oberfeldarzt d. R., wiss. Leiter der Lehr- und Forschungsstelle für Wehrmedizinische Ethik in München
[1] Aquaviva, Claudia: Industriae ad curandos animae morbos, II, 4
[2] World Medical Association: Declaration of Geneva, in: Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch, hrsg. v. Urban Wiesing, Stuttgart: Reclam 42012, 81f.
[3] Bundesärztekammer: (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – MBO-Ä 1997 – in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages 2011 in Kiel, in: Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch, hrsg. v. Urban Wiesing, Stuttgart: Reclam 42012, 82 - 95.
[4] Vgl. Kant, Immanuel: Der Streit der Fakultäten, herausgegeben von Horst Brandt und Piero Giordanetti, Hamburg: Meiner 2005.
[5] zit. nach Müri, Walter (Hrsg.): Der Arzt im Altertum, München: Artemis, 1986 (5. Aufl.), 27.
[6] Zit. n. Engelhardt, Dietrich von: Anthropologische Medizin – historische Entwicklung, Perspektiven der Zukunft, in: Philosophie und Medizin, hrsg. v. Peter Stulz et al., Zürich: Chronos 2006, 25.
[7] Ebd.
Datum: 28.05.2018
Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2018