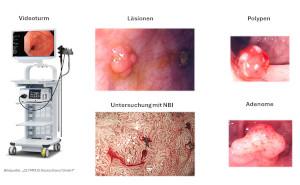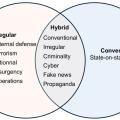Mit Hochdurchsatz-Sequenzierverfahren zu neuen Einblicken in die Wirkung von CT-Untersuchungen auf die Zelle
Hanns Leonhard Kaatscha, Benjamin Valentin Beckerb, Stephan Waldeckb, Matthias Porta, Reinhard Ullmanna
a Institut für Radiobiologie der Bundeswehr, München
b Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Klinik VIII – Radiologie und Neuroradiologie
Hintergrund
Seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren nimmt die Bedeutung der Computertomografie (CT) ständig zu. Allein im Zeitraum 2007 bis 2016 erhöhte sich in Deutschland die Zahl der CT-Untersuchungen um 45 % [1]. Konsequenz dieser Zunahme ist, dass CT-Untersuchungen mittlerweile mehr als 67 % der kollektiven Strahlenbelastung im Zusammenhang mit radiologischen Untersuchungen ausmachen [1] und dies, obwohl die Strahlenbelastung der einzelnen Untersuchung durch technische Weiterentwicklung und Optimierung der Protokolle kontinuierlich reduziert wurde und mittlerweile im Durchschnitt weniger als 6 mSv pro Untersuchung beträgt [5].
Angesichts dieser geringen Strahlenbelastung ist für den Einzelnen und die einzelne CT-Untersuchung nur ein geringes Risiko für Folgeschäden zu erwarten. Sie sind allerdings aufgrund der stochastischen Natur der Effekte nicht vollends ausschließbar und müssen in der allgemeinen Risikoabschätzung vor dem Hintergrund der großen Untersuchungszahlen berücksichtigt werden. Die Abschätzung des Risikos nach Exposition im Niedrigdosisbereich mittels epidemiologischer Ansätze ist jedoch schwierig. Zum Beispiel ist eine etwaige Erhöhung der Tumorhäufigkeit durch diagnostische Strahlenexposition vor dem Hintergrund der statistischen Schwankungsbreite der allgemeinen Tumorinzidenz in der Bevölkerung kaum nachweisbar. M
an behilft sich deshalb mit statistischen Modellen, die – basierend auf dem bei höheren Dosen beobachtetem linearen Zusammenhang zwischen Strahlendosis und Tumorhäufigkeit – das Tumorrisiko bei niedrigen Dosen extrapolieren. Die Aussagekraft solcher statistischen Schätzungen ist nicht unumstritten. In wissenschaftlichen Kreisen wird sowohl das angenommene lineare Verhältnis zwischen Dosis und Tumorwahrscheinlichkeit im Niedrigdosisbereich diskutiert, wie auch die potenzielle Möglichkeit einer Minimaldosis, bei deren Unterschreiten es zu keinerlei Erhöhung des Tumorrisikos kommen könnte [2]. In Anbetracht dieser Unsicherheiten wird schnell klar, dass es für eine wissensbasierte Risikoabschätzung für CT-Untersuchungen ein besseres Verständnis der zellulären Reaktion auf Strahlung im Niedrigdosisbereich braucht.
Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.
Wehrmedizinische Monatsschrift 9-10/2021
Für die Verfasser
Regierungsdirektor Priv.-Doz. Dr. Reinhard Ullmann
Institut für Radiobiologie der Bundeswehr, München
Neuherbergstr. 11, 80937 München
E-Mail: [email protected]