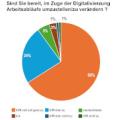„Der Sanitätsdienst der Bundeswehr war und ist ein geschätzter Partner sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene“
Interview mit dem Stellvertreter des Befehlshabers Unterstützungskommando der Bundeswehr, Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Wehrmedizinischen Berater des Verteidigungsministers, Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann
Dr. Andreas Hölscher und Rainer Krug
WM: Herr Generalarzt, der Zentrale Sanitätsdienst hat in den letzten 12 Monaten gravierende Veränderungen erfahren. Können Sie uns zu Beginn die Schwerpunkte dieser Veränderungen aufzeigen und die damit verbundenen Ziele erläutern?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Die Neuaufstellung des Unterstützungsbereiches aus dem Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr und der Streitkräftebasis ist in der Tat ein bislang einzigartiger Schritt. Sie folgt, wie übrigens die gesamte Reorganisation der Bundeswehr, dem Rational des Osnabrücker Erlasses hin zur Rückbesinnung auf den Kernauftrag Landes- und Bündnisverteidigung. Entscheidend hierbei ist, dass der Sanitätsdienst als Ganzes, mit seinen Führungsfähigkeiten und seiner Fachlichkeit innerhalb des Unterstützungsbereiches erhalten bleibt. Auch die Zuerkennung einer höheren taktischen Rolle mit Aufbau des Medical Component Commands sehe ich als klare Stärkung unserer Fachlichkeit. Mit diesem werden wir zukünftig die Federführung bei sanitätsdienstlich dominierten Einsätzen aus dem Unterstützungskommando heraus wahrnehmen – und das weltweit. Denn der Sanitätsdienst ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der personellen Einsatzbereitschaft. So sind wir als Bundeswehr nur dann durchhaltefähig im Sinne von kriegstüchtig, wenn der Sanitätsdienst in der Lage ist, die Einsatzfähigkeit der Verwundeten rasch wiederherzustellen.
WM: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang Ihre Rolle als Stellvertretender Befehlshaber im Unterstützungskommando der Bundeswehr und welchen Stellenwert nimmt der Zentrale Sanitätsdienst in dieser Konstellation ein?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Meine Rolle beschränkt sich ja nicht nur auf diese Funktion. Erstens bin ich der Stellvertreter des Befehlshabers des Unterstützungskommandos. Dies bedeutet, dass ich zu allen Belangen des Unterstützungsbereiches auskunfts- und entscheidungsfähig sein muss. Eine für mich sehr interessante Situation, da ich jeden Tag etwas Neues lerne und meinen Horizont erweitere. Das sehe ich als echte Bereicherung. Zweitens bin ich der Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr, was heißt, dass der Sanitätsdienst unverändert sowohl truppen- als auch fachdienstlich durch einen Sanitätsoffizier geführt wird. Dies ermöglicht mir, aus dem Unterstützungskommando heraus die Sichtbarkeit des Sanitätsdienstes zu fördern, Synergien zwischen den verschiedenen Fähigkeiten, wie beispielsweise ABC-Abwehr und medizinischem ABC-Schutz, zu identifizieren und diese gezielt zu stärken. Drittens bin ich der Wehrmedizinische Berater des Ministers, womit der fachlichen Bedeutung des Sanitätsdienstes auch auf ministerieller Ebene entsprechend Gewicht beigemessen wurde.

WM: Wie Sie schildern, werden die Veränderungen vorrangig zum Erreichen der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung benötigt. Wie hat sich das Kriegsbild bzw. das Szenar mit den sicherheitspolitischen Veränderungen gewandelt und welche besonderen Herausforderungen sind für den Sanitätsdienst damit verbunden?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die zunehmende Gefahr einer Rückkehr von konventionellen Konflikten auf NATO-Bündnisgebiet nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Reorganisation der Bundeswehr wurde mit dem Ziel angestoßen, unsere Streitkräfte umfassend und nachhaltig auf einen solchen Konflikt im Sinne der Landes- und Bündnisverteidigung vorzubereiten. Dazu gehört für den Zentralen Sanitätsdienst vor allem die Rückbesinnung auf den Kernauftrag der Versorgung der Verwundeten auf und am Rande des Gefechtsfeldes.
Unser Ausgangspunkt hierfür ist günstig, so ist der Zentrale Sanitätsdienst ein international geschätzter Partner und bekannt für eine Versorgung auf fachlich hohem Niveau. Die Herausforderung der kommenden Monate wird sein, diese Fähigkeit auf qualitativer Ebene mindestens beizubehalten, und quantitativ an die Aufgaben der Zukunft anzupassen. Erste Schätzungen gehen im Falle eines konventionellen Konfliktes von bis zu 1.000 Verwundeten pro Tag aus, das ist eine Intensität, für die wir weiter aufwachsen müssen. Und wir müssen den Ausbau der zivil-militärischen Kooperation in der Versorgung vorantreiben, denn diese Verwundeten werden im Inland zukünftig hauptsächlich durch zivile Partnerorganisationen behandelt werden.
WM: Was zeichnet aus Ihrer Sicht unseren nationalen Sanitätsdienst besonders aus und was ist zu tun, damit auch in Zukunft dem Prinzip „der Menschlichkeit verbunden“ Rechnung getragen werden kann?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Wie gesagt, der Sanitätsdienst der Bundeswehr war und ist ein geschätzter Partner sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Unser hoher fachlicher, aber auch unser ethischer Selbstanspruch zeichnen uns aus. Wir können zu Recht stolz auf die Leistungen sein, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt haben. Da die Weiterentwicklung und Führung des Sanitätsdienstes auch innerhalb des Unterstützungsbereich weiterhin aus einer Hand erfolgen, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass wir diesen Selbstanspruch, unser Leitbild, vollkommen bruchfrei in den Unterstützungsbereich mitnehmen können. Ziel muss sein, eine Stärkung unserer personellen und materiellen Ressourcen analog zum Aufwuchs der Kampftruppe zu ermöglichen. Unsere Fähigkeiten sind bereits jetzt als knapp bemessene Hochwertressource zu betrachten und müssen dementsprechend priorisiert eingesetzt werden.
WM: Lassen Sie uns einmal das „große Bild“ betrachten: Blicken wir auf die Veränderungen der nationalen Krankenhauslandschaft: Wie schätzen Sie deren Leistungsfähigkeit in einer „scharfen“ Auseinandersetzung ein? Wo muss ggf. noch nachgeschärft werden?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Das deutsche Gesundheitssystems gilt zu Recht als eines der besten Gesundheitssysteme weltweit, die Versorgung findet auf fachlich außerordentlich hohem Niveau statt. Allerdings muss man festhalten, dass der Krisen- bzw. Verteidigungsfall mit ganz eigenen Herausforderungen einhergehen würde. Zum einen die bereits erwähnte konstant hohe Anzahl an Verwundeten, je nach Art und Verlauf des Konfliktes bis zu 1 000 Patientinnen und Patienten täglich. Damit sind erst einmal Soldatinnen und Soldaten gemeint. Die tägliche medizinische Grund-, Akut- und Notfallversorgung der deutschen Bevölkerung käme noch „on top“ hinzu. Zusätzlich wäre Deutschland als europäischer Binnenstaat und Drehscheibe ein Transitgebiet für verbündete Streitkräfte und Geflüchtete aus den umkämpften Gebieten. Auch diese Menschen müssen medizinisch, d.h. im Bedarfsfall stationär, versorgt werden. All dies muss in die Planung mit einfließen. Zusätzlich müssen wir uns verstärkt auf sogenannte hybride Bedrohungen vorbereiten. Krankenhäuser als kritische Infrastruktur müssen in der Lage sein, beispielsweise Cyberattacken standzuhalten und ihren Versorgungsauftrag autark wahrzunehmen. Auch hier haben wir gemeinsam mit den BG- und Universitätskliniken sowie kommunalen Krankenhäusern und Reha-Anbietern eine Reihe von Kooperationen angestoßen.
WM: Welche Rolle nehmen dabei die Bundeswehrkrankenhäuser ein? Sind sie in diesem Kontext herausgehoben oder ordnen sie sich in die allgemeine Organisation ein?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Im Spannungs- bzw. Krisenfall hätten wir es im Bereich des Sanitätsdienstes mit einer Umkehr der bisher gewohnten Strukturen zu tun. Der primäre Auftrag der Bundeswehrkrankenhäuser ist die Aus- und Weiterbildung des medizinischen Fachpersonals des Sanitätsdienstes. Dies stellen wir auch durch enge Kooperation und wechselseitigen Austausch von Personal mit zivilen Partnern sicher. Das heißt, die Bundeswehrkrankenhäuser sind fester Bestandteil der Versorgung und als solche Teil der einzelnen Versorgungspläne der jeweiligen Bundesländer. Im Spannungsfall würde sich dieses Verhältnis umkehren, da der überwiegende Teil des sanitätsdienstlichen Personals mit seinem Auftrag der Versorgung der Truppe im Einsatzgebiet gebunden wäre. Somit würden wir im Verteidigungsfall für die zivile Versorgung eine nur noch sehr untergeordnete Rolle spielen. Insgesamt würden die Bundeswehrkrankenhäuser in den zivilmilitärischen Behandlungsverbund eingegliedert werden. Um die verwundeten Soldatinnen und Soldaten zielgerichtet zu behandeln, und damit unsere Durchhaltefähigkeit zu stärken, muss Verteidigung als gesamtstaatliche Aufgabe begriffen werden, die auch gesamtstaatlich koordiniert werden muss. Auf diese Herausforderungen bereiten wir uns aktuell zusammen mit verschiedenen Akteuren, z. B. den großen Hilfsorganisationen, gezielt vor. So werden wir Anfang Juni ein großes Symposium in Berlin veranstalten, bei dem Vertreterinnen und Vertreter aller beteiligten Stakeholder der gesamtstaatlichen Gesundheitsversorgung Handlungsvorschläge für ein gemeinschaftliches Vorgehen erarbeiten werden.
WM: Lassen Sie uns einen Blick auf die materielle Ausstattung des Sanitätsdienstes werfen. In welchen Bereichen sehen Sie noch vorhandene Lücken – insbesondere, wenn wir auf die logistische Seite des sanitätsdienstlichen Einsatzes sehen?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Was Sanitätsmaterial angeht, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten analog zum zivilen Sektor viele Kapazitäten abgebaut. Während der letzten Krisen hat sich gezeigt, dass eine gewisse strategische Reserve unentbehrlich für die Sicherstellung der gesamtstaatlichen Resilienz ist. Einer der Schwerpunkte wird folglich der Ausbau der logistischen Fähigkeiten im Bereich Sanitätsmaterial, einschließlich Medikamentenproduktion und -bevorratung sowie Versorgung mit Blutprodukten, sein. Hier lassen sich im neuen Unterstützungsbereich der Bundeswehr hervorragend Synergieeffekte erzielen. Eine weitere Fähigkeitslücke, die die gesamte Bundeswehr und fast alle staatlichen Akteure betrifft, ist die der Health Security. Alle medizinischen Einrichtungen, gleich ob militärisch oder zivil, sind als kritische Infrastruktur bevorzugte Angriffsziele in einem möglichen Konflikt. Dies betrifft sowohl die Fähigkeit der sogenannten Cyberresilienz als auch die Resilienz von Strom- und Wasserversorgung, oder die Einrichtung spezieller unterirdischer Schutzräume. Darüber hinaus müssen wir uns mit Blick auf die Erkenntnisse aus dem Angriffskrieg in der Ukraine gezielt mit den veränderten, taktischen Herausforderungen auseinandersetzen. Für ein Gefechtsfeld, das zunehmend gläsern im Sinne einer ständigen Aufklärungsgefahr wird, müssen wir Verwundetentransport und Behandlungseinrichtungen noch mobiler, noch besser geschützt, und wo möglich, in Abstützung auf vorhandene Infrastruktur denken. Dabei werden wir zukünftig auch innovative Lösungen nutzen, beispielsweise durch den Einsatz von Drohnen. Zusätzlich arbeiten wir am Ausbau der Kapazitäten des strategischen Verwundetentransports, sowohl mittels Zügen als auch Schiffen und Bussen.
WM: Eine letzte Frage zum Personal: Ist die Anzahl der aktuell verfügbaren Sanitätsoffiziere für einen Einsatz in Landes- und Bündnisverteidigung ausreichend, sind sie hinsichtlich ihrer Ausbildung ausreichend auf die klinischen Herausforderungen vorbereitet?
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann: Im Hinblick auf die beschriebenen Herausforderungen lässt sich festhalten: Die Zahl des Sanitätspersonals reicht letztendlich nicht aus, um alle Aufgaben zuverlässig zu bewältigen. Wir brauchen einen weiteren Aufwuchs über alle medizinischen Berufsgruppen. Darüber hinaus werden wir weiter einen klaren Fokus auf individuelle Kriegstauglichkeit und das sichere Beherrschen militärischer Grundfähigkeiten legen müssen. Was die fachliche Ausbildung betrifft, müssen wir zukünftig in der Lage sein, unsere medizinische Versorgung auch in einem Umfeld mit begrenzten Ressourcen auf fachlich gleichbleibend hohem Niveau sicherzustellen. Hinzu kommt, dass die Verletzungsmuster einer kriegerischen Auseinandersetzung bislang im medizinischen Tagesgeschäft kaum eine Rolle spielen. Wir reden hier z. B. von sogenannten Blast Injuries, also Explosionstraumata sowie Schrapnellverletzungen. Aus diesem Grund haben wir bereits mehrere zivil-militärische Kooperationsprojekte angestoßen, um gemeinsam unter anderem kriegschirurgische Fähigkeiten auszubilden. Darüber hinaus dürfen wir nicht den Blick für nicht-traumatologische Erkrankungsmuster verlieren. Die Prävention und Behandlung von beispielsweise Infektionserkrankungen spielt auch in modernen Konflikten eine entscheidende Rolle, da diese genauso wie Verletzungen zu zahlreichen Ausfällen führen können und somit die Kampftauglichkeit und Durchhaltefähigkeit gefährden.
WM: Herr Generalarzt, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen für die vor Ihnen liegenden Herausforderungen viel Kraft und Soldatenglück.
Das Interview führten Generalarzt a. D. Dr. Andreas Hölscher, Chefredakteur der Wehrmedizin und Wehrpharmazie und Rainer Krug, Chefredakteur des CPM FORUM.
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2 / 2025
Generalarzt a. D. Dr. Andreas Hölscher,
Chefredakteur der Wehrmedizin und Wehrpharmazie
Rainer Krug,
Chefredakteur des CPM FORUM.