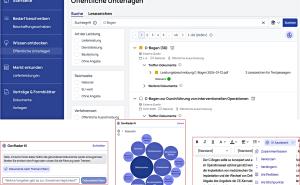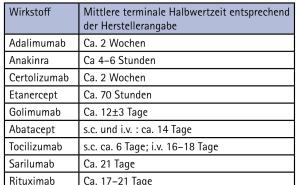Die Notfall- und Katastrophenpharmazie im Zeichen der Zeitenwende
S. Seißelberg, F. Vongehr
Grundsätzlich obliegt den Apotheken in Deutschland die ordnungsgemäße Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Dies gilt uneingeschränkt auch in Zeiten von Krisen und Katastrophen. Um diesen gesetzlichen Auftrag vollumfänglich auch in solchen Lagen zu erfüllen, bedarf es struktureller Vorbereitungen der Apotheken im Rahmen der Notfall- und Katastrophenpharmazie.
Insbesondere die Corona-Pandemie sowie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben gezeigt, dass ein Umdenken in allen Bereichen der Notfallvorsorge notwendig ist. Dies gilt selbstverständlich auch im Bereich der Arzneimittel- bzw. gesamtheitlich der Sanitätsmaterialversorgung, als wichtigem Standbein des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes. Um auch zukünftig eine resiliente Sanitätsmaterialversorgung insbesondere durch Öffentliche- und Krankenhausapotheken sicherstellen zu können, bedarf es einer Anpassung des bestehenden Systems, denn die letzten Jahre haben hier deutliche Lücken aufgezeigt, die unter dem aktuellen wirtschaftlichen Druck bei der Regelversorgung mit Arzneimitteln noch größer werden. Um notwendige Ableitungen für die Zukunft zu treffen, ist zunächst ein Blick in die Vergangenheit und die Darstellung des Status quo unumgänglich.
Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die Entwicklungen des Kalten Krieges eine zentrale Bevorratung von Sanitätsmaterial durch den Bund im Rahmen der allgemeinen Notinfrastruktur im Gesundheitswesen – insbesondere mit dem Blick auf die erhebliche Gefahr eines Krieges – in Deutschland notwendig. Hierzu wurden auf Grundlage des damaligen § 14 ZSG verteilt über die BRD bis zum Jahr 1980 ca. 190 Sanitätslager eingerichtet, mit eingelagertem Sanitätsmaterial für die dreiwöchige Versorgung von ca. 250 000 Patienten. Diese waren zumeist im örtlichen Zusammenhang mit vorgesehenen Hilfskrankenhäusern angesiedelt. Die Bevorratung wurde zentral gesteuert und erfolgte zumeist im Rahmen der Bevorratung von „Bulkware“. Hierunter versteht man große Mengen von z. B. Tabletten in definierten Großbehältnissen. Die Lagerung folgte nicht dem Prinzip der heute gängigen Wälzung des Materials, sondern vielmehr der kontinuierlichen Überwachung und Chargenfreigabe nach Untersuchung, um den Verwurf von Material möglichst gering zu halten. Geregelt wurde der Umgang mit dem eingelagerten Sanitätsmaterial in den Richtlinien für die Lagerung und Wartung von Sanitätslagern für den Zivilschutz. Gleichzeitig standen die durch den Bund beschafften Ressourcen auch den Ländern für den Katastrophenfall zur Verfügung. Für die seinerzeit errichteten Sanitätslager gab es klare Vorgaben, um insbesondere die Logistik problemlos zu ermöglichen. Die Fokussierung auf eine optimal mögliche Logistik ist ein Kernpunkt, um die Ressourcen schnellstmöglich an den jeweiligen Einsatzorten zum Einsatz zu bringen. Nach Ende des Kalten Krieges wurden im Rahmen der Wiedervereinigung die zentrale Bevorratung, die in ähnlicher Form auch in der DDR bestand, analog zum flächendeckenden Rückbau großer Teile des Zivilschutzes aufgrund der veränderten Gefahrenlage nahezu vollständig aufgegeben. Die eingelagerten Bestände wurden im Rahmen von humanitären Hilfsleistungen über die Welt verteilt. In der weiteren Planung von Krisen- und Katastrophenszenarien fand zunehmend der Verweis auf die reguläre Infrastruktur der Apotheken statt, zumal in den Apotheken entsprechende Bevorratung gemäß der Apothekenbetriebsordnung im Maßstab von ca. einer Woche erfolgte. Zur Jahrtausendwende begannen auf Ebene des Bundes erneut Überlegungen eines teilweisen Aufbaus von zentraler Bevorratung, insbesondere mit dem Fokus auf den Massenanfall von Verletzten. Diese Bevorratung erfolgt durch fest definierte Pakete, die in Krankenhausapotheken in den regulären Betriebsablauf eingebunden sind, um eine Wälzung zu erzielen und die Beschaffungs- und Unterhaltskosten zu reduzieren. Aktuell stehen nach § 23 Abs. 1 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz an ca. 45 Standorten Pakete mit einem Umfang von Sanitätsmaterial für jeweils bis zu 250 Patienten und 3 Tage intensive Versorgung zur Verfügung. Der Fokus dieser Pakete liegt klar im Bereich Traumaversorgung und klammert die Regelversorgung der Bevölkerung aus. Die Vorräte des Bundes können durch die Bundesländer in die jeweilige Katastrophenvorsorge eingeplant werden, gleichzeitig bestehen jedoch weitere uneinheitliche Bevorratungen von zusätzlichem Sanitätsmaterial der einzelnen Bundesländer.

Neben der zivilen Bevorratung wurde in den Diskussionen der letzten Jahre immer wieder auf die Bevorratung der Bundeswehr verwiesen, die ggf. im Rahmen der Amtshilfe in Krisen- und Katastrophenszenarien auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen könne. Hierbei wurde verkannt, dass die Bundeswehr die Transformation hin zu einer Einsatzarmee durchlief und hier ebenfalls eine Anpassung der Bevorratungsstrategie vorgenommen wurde sowie große Bestände abgebaut wurden. Aktuell muss vielmehr diskutiert werden, inwieweit die aktuelle Sanitätsmaterialversorgung im Falle einer Bündnis- bzw. Landesverteidigung ausreichend resilient aufgebaut werden kann. Dazu tritt ferner, wie konkret die Einbindung der inländischen Strukturen in die Versorgung von Armeeangehörigen erfolgen muss, um die dann zu erwartenden zusätzlichen Belastungen des Gesundheitswesens in Deutschland erfolgreich bewältigen zu können.
Einhergehend mit der Corona-Pandemie wurden die bestehenden Mängel im jetzigen System bereits sehr deutlich. So gab es insbesondere in der Frühphase der Pandemie erhebliche Ressourcenprobleme bei Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung, die einerseits auf fehlende Bevorratung und andererseits auf fehlende gesetzliche Regelungen zurückzuführen sind, was insbesondere die notfallmäßige Herstellung von Desinfektionsmitteln in Apotheken erheblich erschwerte. Darüber hinaus hat spätestens die Corona-Pandemie gezeigt, dass die aktuelle Versorgung mit den entsprechenden Lieferwegen aus Asien für äußere Angriffe deutlich empfindlicher ist. Ausweichplanungen wie etwa die Herstellung von essenziellen Arzneimitteln im eigenen Land sind nicht kurzfristig umsetzbar und bedürfen mindestens einer Vorratshaltung von Ressourcen, die aktuell nicht strukturiert vorhanden ist. Wie dringend diese Planungen notwendig sind, wird deutlich an der Tatsache, dass im Bereich der generischen Wirkstoffe, die den Hauptteil der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln ausmachen, mittlerweile mehr als 60 % der Wirkstoffe ausschließlich im asiatischen Raum produziert werden. Darüber hinaus ist aktuell zu beobachten, dass zunehmend Apotheken den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf Versorgungssituationen in Krisenphasen, da die Versorgung durch eine nicht mehr flächendeckende Präsenz von Apotheken dezentral erfolgt und bei einer entsprechenden Zentralisierung des Systems eine entsprechende Logistik mitbetrachtet werden muss. Gleichzeitig ist durch die zunehmende Zentralisierung zu berücksichtigen, dass die Anfälligkeit des Systems zunimmt. Exemplarisch ist hierbei das Thema Cyberangriffe hervorzuheben. Durch zunehmend digitalisierte Prozesse insbesondere im Rahmen der Arzneimitteldistribution stehen im Falle einer Störung digitaler Systeme ggf. vorhandene Ressourcen nicht zur Nutzung zur Verfügung. Hier gilt es, frühzeitig entsprechende Ausfall- und Ersatzplanungen vorzunehmen, um die vorhandene Ressource Sanitätsmaterial optimal zu nutzen. Entscheidend hierbei ist der Einbezug der gesamten Lieferkette von Sanitätsmaterial in die Planungen, da besonders bei Arzneimitteln aktuell ein hoher Anteil von Just-in-Time Versorgung aus nachgelagerten Anteilen der Lieferkette, hier mit Schwerpunkt des pharmazeutischen Großhandels, in die Apotheken erfolgt.
Um auch zukünftig eine resiliente Arzneimittelversorgung in Krisen und Katastrophen sicherzustellen, bedarf es aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Notfall- und Katastrophenpharmazie der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft e. V. (AG KatPharm) folgender Rahmenbedingungen:
- Konsequente Einbindung von pharmazeutischem Wissen und Strukturen in Planungsprozesse zum Gesundheitlichen Bevölkerungsschutz, insbesondere für den Bereich Sanitätsmaterial
- Einbindung der Grundlagenausbildung des pharmazeutischen Notfallmanagements bereits in das Pharmaziestudium
- Schaffung von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zur Notfall- und Katastrophenpharmazie auf Landes- und Bundesebene
- Konsequente Einbindung der Arzneimittelversorgung in ein zukünftiges Gesundheitsvorsorge- und -sicherstellungsgesetz
- Deutlichere Einbindung sowohl von Öffentlichen als auch Krankenhausapotheken in regionale Netzwerke im Bereich Katastrophenschutz
- Ausreichende Finanzierung und Förderung in den krisenfesten Ausbau vorhandener Strukturen. Dies insbesondere unter dem Aspekt des niederschwelligen Zugangs der Bevölkerung zu Gesundheitsinformationen durch Apotheken und der Nutzung von vorhandenen Ansprechpartnern zur Resilienzbildung der Bevölkerung (Stichwort Hausapotheke)
Dieser Beitrag wurde erstveröffentlicht in dem Fachmagazin Crisis Prevention 1/2025.
Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2025
Sven Seißelberg
Apotheker und Diplompharmazeut
Stellv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Notfall- und Katastrophenpharmazie der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft e. V.
Dr. Frederik Vongehr
Apotheker
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Notfall- und Katastrophenpharmazie der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft e. V.