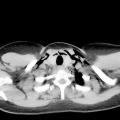DER CHIRURGISCHE NACHWUCHS DER BUNDESWEHR IM FACHGEBIET ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE - BESTANDSAUFNAHME UND AUSBLICK FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT
The German Armed Forces Next Generation in Orthopedics and Trauma Surgery - Survey and Perspective for a Successful Future
Gerhard Achatz, Dan Bieler, Kay Beckmann, Christoph Schulze, David Back
WMM, 58. Jahrgang (Ausgabe 12/2014; S. 421-426)
Zusammenfassung:
In der Medizin wird in den kommenden Jahren ein eklatanter Nachwuchsmangel befürchtet; dies scheint insbesondere auch für den Bereich der Chirurgie zu gelten. Ändert sich zudem die Einstellung des Nachwuchses zum chirurgischen Berufsbild, treten Aspekte wie z.B. der Wunsch nach einer enger gefassten und spezialisierten Weiterbildung, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einer ausgewogenen Work-Life-Balance in den Vordergrund - eine Situation, die es scheinbar notwendig macht, die Bedürfnisse und Wünsche des Nachwuchses zunehmend mehr wahrzunehmen und zu beachten.
Umgekehrt bringt sich jedoch der Nachwuchs gerade auch auf Ebene der Fachgesellschaften und Berufsverbände zunehmend ein, um damit die Rahmenbedingungen und zukünftigen Optionen seines Berufsfeldes aktiv mitzugestalten. Auch für die Bundeswehr als Arbeitgeber im Bereich der Medizin, und im Speziellem im Bereich der Chirurgie, wird es wichtig sein, die Vorstellungen und Bedürfnisse der kommenden Chirurgengeneration zu evaluieren und zu berücksichtigen, um so im Wettbewerb um qualifizierten Nachwuchs attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben.
Schlüsselwörter: Chirurgie, Nachwuchs, Weiterbildung, Wissenschaft, Familie und Beruf
Summary
A blatant lack of residents in medicine can be suspected in the coming years, which seems to apply to the field of surgery in particular. The attitudes of residents in surgery are changing too; aspects like the desire for a more specialized education, a better reconciliation of work and family life and a healthy work-life balance become increasingly important. A situation that seems to make it important to pay more and more attention to the requirements and wishes of residents. Conversely, residents are engaged more and more in surgical societies and associations to reinforce the conditions and future options for young surgeons actively. It will be important for the Bundeswehr Medical Service as an employer of medical professionals (especially in the field of surgery) too to evaluate the ideas and requirements of residents, in order to remain attractive and competitive for qualified young colleagues.
Keywords: surgery, residency, education, sciences, work and family life
Einleitung
Die Nachwuchssituation in der Chirurgie wird aktuell von vielen Seiten sehr genau beleuchtet, da u. a. ein eklatanter Nachwuchsmangel befürchtet wird, sich die Einstellung des Nachwuchses für die Tätigkeit im Bereich der Chirurgie ändert und u. a. Aspekte wie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance in den Vordergrund treten [1 - 3]. Es besteht also eine Situation, die es notwendig macht, die Bedürfnisse und Wünsche des Nachwuchses zunehmend mehr wahrzunehmen und stärker zu beachten [4].
In diesem Sinne darf dazu wohl auch die folgende Äußerung des Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Montgomery, verstanden werden: „Junge Menschen mit einer hochqualifizierten Ausbildung sind zu Recht nicht mehr bereit, ihren Lebensstil, ihre Lebensqualität und ihre Arbeitnehmerrechte an den Pforten der Krankenhäuser und Arztpraxen abzugeben.“ [5] - eine Formulierung und Einschätzung, mit der sich auch der Sanitätsdienst der Bundeswehr konfrontiert sieht.
Umgekehrt sind es jedoch zunehmend auch junge Kolleginnen und Kollegen, die sich auf der Ebene von Fachgesellschaften und Berufsverbänden engagieren, um damit die Rahmenbedingungen und zukünftigen Optionen für den chirurgischen Nachwuchs aktiv mitzugestalten. Schwerpunktmäßig werden hier die Themenfelder Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung und auch sog. Social-Topics, wie z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf u. ä., bearbeitet. Die Fachgesellschaften wiederum nehmen dieses Engagement gerne auf und binden den Nachwuchs hier aktiv und durchaus adäquat ein. So implementierte die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie zuletzt das „Perspektivforum Junge Chirurgie“ mit einer ständigen Vertretung im Vorstand, ebenso ist in der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie der Nachwuchs durch das „Junge Forum“ im Vorstand vertreten.
Die Bundeswehr im Wettbewerb
Den Anforderungen als attraktiver Arbeitgeber muss sich auch die Bundeswehr zunehmend stellen - und das besonders in Bereichen, in denen zu den abgebildeten Berufsgruppen unmittelbar zivile Vergleichsgruppen existieren. Dies gilt in ganz besonderem Maße für die Medizin, aber auch z. B. für den IT-Sektor oder die Luftfahrt. Im medizinischen Bereich ist hierbei die Chirurgie aufgrund der aktuellen und zukünftigen Verpflichtungen und Einsatzoptionen als besonders aufmerksam anzusehen und zu bewerten.
In diesem Zusammenhang formuliert Dr. med. Jörg Ansorg als Hauptgeschäftsführer des Berufsverbands Deutscher Chirurgen sehr treffend: „Der Nachwuchsmangel ist nicht nur gefühlt, sondern real. Der Wettbewerb um gute Chirurgen und motivierten Nachwuchs hat längst begonnen.“ [6]
Für den Sanitätsdienst ist es daher wichtig, eine Einschätzung von den Vorstellungen und Bedürfnissen des Nachwuchses zu haben. Besonders die Ausscheiderate jeweils gut ausgebildeter Sanitätsoffiziere zum Ende ihrer Dienstzeit als Soldat auf Zeit und damit in einem Lebensalter um 40 Jahre unterstreicht dieses. Diese Kolleginnen und Kollegen verlassen die Bundeswehr in einer Phase ihres Berufslebens, in der sie gerade große berufliche Leistungsfähigkeit erlangt haben sowie über eine umfassende Ausbildung verfügen, was sie besonders interessant für jeden Arbeitgeber macht.
Es lohnt daher und ist mittlerweile unabdingbar, die Nachwuchssituation bei der Bundeswehr zu beleuchten und für die Zukunftsgestaltung zu berücksichtigen. Eine erste Einschätzung dazu, im Schwerpunkt zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung und zu ausgewählten „Social Topics“, soll dieser Beitrag geben.
Aus- und Weiterbildung
Die Bundeswehr übernimmt im Rahmen ihres politischen Auftrags mittlerweile zahlreiche internationale Verpflichtungen zur Krisenprävention und Friedenssicherung. Bei sich daraus ergebenden Auslandseinsätzen drohen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten gesundheitliche Gefahren, denen Sie im Heimatland nicht ausgesetzt sind. Die Maxime des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, den Soldaten im Falle einer Erkrankung, eines Unfalles oder einer Verwundung eine medizinische Versorgung zuteil werden zu lassen, die im Ergebnis dem fachlichen Standard in Deutschland entspricht, stellt dabei die Grundlage unseres medizinischen Handelns dar. Entspricht die Versorgung im Heimatland den spezialisierten Versorgungsstrukturen des zivilen Gesundheitssystems, bilden im Rahmen der Auslandseinsätze insbesondere Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem Bereich der Akut- und Notfallchirurgie die Schlüsselkompetenz. Um die Versorgung auf chirurgischem Fachgebiet sowohl im Heimat- als auch im Einsatzland sicherstellen zu können, bedarf es einer besonderen und umfänglichen Ausbildung.
Der Einsatzchirurg als aktuelles Konzept
Für das Fachgebiet Chirurgie wird hier aktuell das Konzept der Ausbildung zum „Einsatzchirurgen“ verfolgt. Dies bedeutet im Hinblick auf die Facharztweiterbildung, die den Richtlinien der Weiterbildungsordnung der Ärztekammern entspricht, dass nach einer zunächst erfolgenden Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie im zweiten Schritt eine spezialisierte Weiterbildung, z. B. zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, anschließt (Duo-Facharzt-Konzept). Dabei wird gerade im Rahmen der Weiterbildung zum Allgemeinchirurgen ein deutlicher Schwerpunkt auf die Ausbildungsbreite gelegt. Dem Common-Trunk für Chirurgie folgen 18 Monate Weiterbildungszeit für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, 18 Monate für Unfallchirurgie und Orthopädie mit ergänzend rekonstruktiv- septischer Chirurgie sowie 12 Monate Gefäßchirurgie [7]. Damit sollen alle notwendigen Akut- und Notfallkompetenzen zur gesamtheitlichen Versorgung des Traumapatienten vermittelt und das Verständnis um das Krankheitsbild „Trauma“ per se geschult werden - eine für die Einsatzsituation unabdingbare Kompetenz.
Hinzu kommen zu diesem Weiterbildungscurriculum verschiedenste Fortbildungskurse, welche die Inhalte der aufgezeigten Weiterbildung festigen und weiterentwickeln und zudem den Blick über den chirurgischen Tellerrand, z. B. hinein in den Bereich der Neurochirurgie, ermöglichen [7].
Die aus Einsatzgründen in der Bundeswehr so erfolgende Weiterbildung im Fachgebiet Chirurgie verläuft dabei konträr zu den Entwicklungen im zivilen Bereich. Dort nimmt die Spezialisierung deutlich zu, sind selbst innerhalb der einzelnen chirurgischen Fachdisziplinen deutliche Aufteilungen in spezialisierte und teils sogar subspezialisierte Teilbereiche zu erkennen und tritt die Bedeutung einer breiten Ausrichtung der Weiterbildung und auch der täglich klinischen Routine in den Hintergrund [8 - 11]. Somit ergeben sich teils entgegengesetzt verlaufende Entwicklungen und ein entsprechend anderes Tätigkeitsprofil für die Chirurginnen und Chirurgen der Bundeswehr: Auf der einen Seite im Heimatland spezialisiert und dem zivilen Bereich vergleichbar in den Bundeswehrkrankenhäusern (BwKrhs) arbeiten und hier auch einen hohen Anteil ziviler Patientinnen und Patienten als anerkannter Partner in den jeweiligen regionalen Versorgungsstrukturen behandeln und auf der anderen Seite im Einsatzland entsprechend die sog. Einsatzchirurgie - als „Kümmerer um den Traumapatienten“ - abbilden.
Fehlentwicklungen im zivilen Gesundheitssystem
Die oben aufzeigte Entwicklung im zivilen Bereich wird durchaus zunehmend kritisch bewertet, erste Einschätzungen und Ansätze auf Ebene der Fachgesellschaften bestätigen dies. Auf die Risiken einer zunehmenden Spezialisierung wies Allgöwer schon im Jahre 1974 hin. Er postulierte, dass eine solche Entwicklung auch große Gefahren in sich berge. Diese führe zu relevanten sozioökonomischen Konsequenzen, da in den chirurgischen Zentren Chirurginnen und Chirurgen ausgebildet werden, die den Aufgaben der alltäglichen Notfallversorgung nicht mehr gewachsen wären. Dadurch würde eine Medizin entstehen, die man sich volkswirtschaftlich auf Dauer nicht leisten könne [12].
Dass diese Einschätzung aus 1974 weiterhin aktuell ist, wird heutzutage auch von politischer Seite in ähnlicher Weise formuliert. Dr. Klaus Schulenburg, Verantwortlicher des Bayerischen Landkreistages für das Krankenhauswesen, formuliert dazu: „Die zunehmende Spezialisierung wird zu einem Rückzug der Grundversorgung aus der Fläche und damit zu erheblichen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen führen. Daher müssen sich Politik und Aufgabenträger die Frage stellen, ob Sie nicht die finanziellen und fachlichen Voraussetzungen für eine parallele Grundversorgungsstruktur mit ärztlichen Generalisten, allg. Fachabteilungen, etc. schaffen“ [13]. Und auch auf fachgesellschaftlicher Ebene wird die Brisanz dieses Themas gerade für den Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie durch ein klares Statement der Präsidenten des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie 2013 unterstrichen: „Wir brauchen wieder mehr Generalisten!“ [14]
Die Notwendigkeit der breiten Ausbildung – zivil und militärisch
Zuletzt fand diese Thematik auch Eingang in relevante und die medizinische Versorgung auf höchstem Niveau regelnde Vorgaben, wie z.B. in das „Weißbuch Schwerverletztenversorgung“ der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) [15]. Hier wird eindeutig der Bedarf nach beiden Positionen im Fachgebiet gefordert bzw. als notwendig erklärt: „Es wird auf Dauer nicht möglich sein, für jede Verletzung den jeweiligen „Spezialisten“ im Bereitschafts- oder Rufdienst vorzuhalten, oftmals für mehrere Patienten. Die Weiterbildung im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie und insbesondere in der vertiefenden Zusatzweiterbildung zum Speziellen Unfallchirurgen muss, trotz aller Spezialisierung, den Erwerb einer fachlich breiten Qualifikation gewährleisten. Dies bedingt, dass sowohl Generalisten, als auch Spezialisten sinnvoll in den Krankenhausstrukturen vorgehalten werden, um sich gegenseitig unterstützen und fördern zu können.” [8 - 11, 15, 16]
Für den Sanitätsdienst, und insbesondere für die Chirurgie bei der Bundeswehr, ergibt sich die Ausrichtung primär aus den Erfordernissen des Auftrags. Damit steht die Versorgung der anvertrauten Soldatinnen und Soldaten im Fokus, die bis dato über das Konzept zur Einsatzchirurgie gemäß Weisung Nr. 1 des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sichergestellt wird [7]. In der Praxis bedeutet dies, dass aktuell ein fachlich erfahrener Chirurg mit Abschluss entsprechender Facharztqualifikationen zusammen mit einem jüngeren, meist in Weiterbildung befindlichen Assistenzarzt im Einsatz als chirurgisches Team fungiert. Dieses Konzept hat sich nun seit vielen Jahren bewährt; es konnte gezeigt werden, dass der Spagat zwischen der Tätigkeit als „Spezialist“ im Heimatland an den Bundeswehrkrankenhäusern und der Tätigkeit als „Generalist“ im Einsatzland möglich ist.
Die aktuelle Situation aus Nachwuchssicht
In den Reihen des chirurgischen Nachwuchses und zuletzt ebenso auf klinischer Führungsebene wird diese Konzeption zur Einsatzchirurgie auf der Basis des sog. Duo-Facharzt-Konzeptes immer wieder hinterfragt; dabei werden auch Stimmen laut, die eine Neuausrichtung dieser Konzeption und damit eine Anlehnung an das Konzept anderer Nationen in der Einsatzsituation fordern. Unter dem Stichwort „Fighting-in-Pairs“ entsenden verschiedene Nationen, wie z. B. die USA und Großbritannien, nun Teams, welche in der Regel aus zwei oder mehr spezialisierten Chirurginnen bzw. Chirurgen bestehen. Diese kümmern sich dann auch im Einsatz fachgebietsbezogen um die auftretenden chirurgischen Erkrankungen und Verletzungen. Die Beweggründe, diese konzeptionelle Neuausrichtung auch auf Nachwuchsebene zur Diskussion zu stellen, scheinen vielschichtig.
Bei einer Umfrage in den BwKrhs, an der sich 66 Sanitätsoffizieren (chirurgische Weiterbildungsassistentinnen / -assistenten bzw. junge Fachärztinnen / -ärzte mit bis dato erreichter Qualifikation Allgemeinchirurgie) beteiligten, konnte ein erstes Meinungsbild abgeleitet werden, welches nähere Informationen dazu gibt:
78 % der befragten Kolleginnen und Kollegen erachten die Weiterbildung primär zum Facharzt für Allgemeinchirurgie im Sinne des sog. „Duo-Facharzt - Konzeptes“ als sinn- und wertvoll. Dabei zeigt sich kein wesentlicher Unterschied im Hinblick auf die jeweilige Ausbildungsstufe bzw. das Weiterbildungsjahr, in dem sie sich befanden. Vielmehr schätzen ebenso 78 % die damit erhaltene breite Ausbildung als wertvoll auch für ihre spätere spezialisierte Tätigkeit, z. B. als Unfallchirurg und Orthopäde, ein.
Befragt nach der eigenen Bewertung des Konzeptes der Einsatzchirurgie, wie es aktuell in unseren Einsätzen auch gelebt wird, gaben 70 % an, dieses Konzept für sinnvoll zu erachten, wobei jedoch auch anzuführen ist, dass 74 % eine Einsatzoption im Sinne eines Team-Approachs, wie z. B. eine „Fighting-in- Pairs-Option“ (z. B. Facharzt für Viszeralchirurgie + Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie), präferieren würden. Diese sich anhand der letzten beiden Punkte darstellende Divergenz kann möglicherweise durch eine genauere Betrachtung im Hinblick auf den jeweiligen Ausbildungsstand erklärt werden, da gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den ersten drei Weiterbildungsjahren diese Präferenz formulierten. Vielleicht ist dieses Ausdruck einer möglichen Befürchtung, den Anforderungen an den Einsatzchirurgen nicht gerecht werden zu können - einzelne ergänzend abgegebene Kommentare lassen dies tendenziell vermuten, auch wenn dieser Zusammenhang abschließend nicht sicher aus der Umfrage abgeleitet werden kann. Diese Überlegung wird jedoch auch unterstrichen, wenn man sich die Frage anschaut, ob sich die Kolleginnen und Kollegen für die Anforderungen im Einsatz gut und ausreichend vorbereitet und diesen gewachsen sehen. Diese Bewertung geben nur 50 % für sich ab, wobei auch hier tendenziell aus den Reihen der jüngeren Kolleginnen und Kollegen entsprechende Negativ-Einschätzungen genannt wurden.
Es muss jedoch ergänzend angeführt werden, dass beim aktuellen Personalschlüssel der Chirurgie der Bundeswehr ein „Fighting- in-Pairs“ - Konzept nur durch eine Erhöhung der Einsatzdauer oder -frequenz zu ermöglichen wäre. Dieses lehnen jedoch 60 % der befragten Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachwuchsbereich ab und sehen diesen Aspekt vielmehr auch als ganz wesentlich für die Attraktivität des Arbeitgebers per se an. Hier lässt sich also eine Konfliktsituation erkennen, die sich einerseits aus einer zum Teil gewünschten Kompetenz- und damit folgend wohl auch Verantwortungsaufteilung in der Einsatzsituation einerseits und einer nicht gewünschten Erhöhung der Einsatzpräsenz anderseits ergibt.
Damit wird man wohl einen Anteil von 78 % für die Befürwortung des bisherigen Konzeptes als Ausdruck einer Bestätigung für die Einsatzchirurgie im bisherigen Sinne werten dürfen.
Aus der Fachlichkeit würde zudem sowieso ein Aspekt unberücksichtigt bleiben, wenn man über ein mögliches „Fightingin- Pairs - Konzept“ nachdenkt. Da dieses in den Diskussionen in der Regel immer als Teambildung eines Unfallchirurgen und Orthopäden zusammen mit einem Viszeralchirurgen verstanden wird, bleibt ganz einfach formuliert die Frage: „Und wer versorgt das Gefäß?“ Gerade da die Gefäßverletzung in der Einsatzsituation nicht selten die unmittelbarste und relevanteste Bedeutung im Hinblick auf die Versorgung und Stabilisierung des Patienten quo ad vitam hat, darf man diesen Aspekt in dieser Diskussion keineswegs außer Acht lassen [17 - 19]. Hier also „auf Lücke“ zu spielen, wäre gerade vor dem Hintergrund der sanitätsdienstlichen Maxime nicht akzeptabel. Vielmehr scheint eine adäquate Aus- und Weiterbildung der Lösungsansatz zu sein.
Es bleibt die Verantwortung!
Somit muss die Diskussion um das Bild der zukünftigen Einsatzchirurgie sicher weiter geführt und beleuchtet werden, da mögliche Verbesserungen für die uns anvertrauten Soldatinnen und Soldaten stets zu unterstützen sind. Denn diese dürfen den Anspruch auf eine qualitativ hochwertige und bestmögliche Versorgung formulieren – dies muss der Selbstanspruch im Sinne der Einsatzchirurgie per se sein. Es scheint jedoch die aktuelle Konzeption auch aus der Mehrheit des chirurgischen Nachwuchses der Bundeswehr getragen zu sein.
Wissenschaft und Forschung
Die wissenschaftliche Betätigung nimmt im Fachgebiet Chirurgie weiter einen hohen und wichtigen Stellenwert ein, wobei die Anforderungen an die Qualität der Forschung in den chirurgischen Fachgebieten dabei in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und in ständiger internationaler Konkurrenz stehen [20].
In den Einrichtungen der BwKrhs werden wissenschaftliche Fragestellungen traditionsgemäß seit vielen Jahren bearbeitet; dabei erfolgt dieses in der Regel aber nicht selten als „Forschung im Nebenamt bzw. in der Freizeit“. Trotz dieser Rahmenbedingungen wurden dabei bis dato zahlreiche qualifizierte und qualitativ wissenschaftlich hochwertige Ergebnisse erzielt, konnten nicht wenige Promotionsarbeiten abgeschlossen und in mehreren Fällen auch das Ziel der Habilitation erreicht werden.
Interesse an Forschung ja, Engagement weniger
Die aktuelle Situation der Forschungsmöglichkeiten innerhalb der Chirurgie bei der Bundeswehr und die dabei entsprechend anzutreffenden Rahmenbedingungen wurden nun jüngst durch die Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft Forschung (AG Forschung) und des Arbeitskreises chirurgisch tätiger Sanitätsoffiziere (ARCHIS) bei der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie (DGWMP) aufgegriffen. Anhand einer entsprechenden Umfrage unter den chirurgisch tätigen Sanitätsoffizieren der Bundeswehr konnten Back et al. zeigen, dass Wissenschaft und Forschung weiterhin eine wesentliche Rolle spielen [21]. Von abschließend an der Umfrage teilnehmenden 87 Chirurginnen und Chirurgen bekräftigten 81 % ein generelles Interesse an Forschung und Wissenschaft, aktiv gingen zum Zeitpunkt der Befragung jedoch nur 32 % wissenschaftlichen Fragstellungen nach.
Diese Tendenz konnten auch Ahn et al. zeigen, die in ihrer Arbeit ebenso ein generelles Bewusstsein für die Forschung und Wissenschaft innerhalb der Orthopädie und Unfallchirurgie feststellten [22]. Alle befragten Weiterbildungsassistenten erachteten Forschung für die klinische Praxis als wichtig, jedoch waren auch hier nur 42 % an eigenen Forschungsaktivitäten generell interessiert, 28 % zeigten sich unentschlossen und 30 % hatten kein Interesse an Forschung. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass aus dem befragten Kreis der an Forschung interessierten 64 % an klinischer Forschung interessiert waren, an Grundlagenforschung überhaupt jedoch nur 20 %.
In der Arbeit von Back et al. wurden für diese Diskrepanz von den Befragten am häufigsten Zeitmangel, fehlende Forschungsvorhaben bzw. -ideen, Frustration nach ersten Misserfolgen sowie andere Interessen und keine gefühlte Förderung für den Bereich der Wissenschaft genannt [21]. Betrachtet man als weiteren Faktor das Vorliegen einer abgeschlossenen oder in Bearbeitung befindlichen Promotionsarbeit, kann die Situation nochmals genauer dargestellt werden. Von den 87 Befragten waren 44 promoviert, 26 arbeiteten an einer Promotion, 12 bekundeten generelles Interesse und 3 gaben an, kein Interesse an dem Abschluss einer Doktorarbeit zu haben. Dieses zeigt zusammenfassend, dass nur 50 % der Befragten eine wissenschaftliche Arbeit zum Zwecke der Promotion abgeschlossen hatten. Bewertet man die Promotion nun als eigentlich ersten Schritt einer wissenschaftlichen Arbeit, stellt dieser Wert mit lediglich 50 % eine eher geringe Wertigkeit dar. Als Hauptgründe, warum eine entsprechende Arbeit jedoch (noch) nicht zum Abschluss gebracht bzw. umgesetzt wurde, wurden ähnlich zum bereits Dargestellten folgende Gründe angeführt: Arbeitszeitbelastung, klinische Arbeit wichtiger, private Gründe, Vorarbeiten aus verschiedenen Gründen gescheitert, kein interessantes Themengebiet im Umfeld gefunden. Werden Forschung und wissenschaftliche Betätigung generell als durchweg positiv und sinnvoll erachtet, ist die abschließend wirkliche Beschäftigung damit deutlich geringer [21].
Forschung ist mehr als bloße „Beschäftigung nebenbei“
Zusammenfassend kann man also formulieren, dass eine zunehmende Arbeitsverdichtung in den klinischen Strukturen unserer BwKrhs einerseits und die veränderte Einstellung zum Beruf im Generellen, mit einer anderen Gewichtung des Themenbereiches Work-Life-Balance, hier entscheidend erscheinen, wobei damit die wesentlichen Aspekte der Situation in den zivilen Strukturen ähneln [20]. Hinzu kommen nun in den Einrichtungen der BwKrhs eine bis dato im Auftrag und damit z.B. auch in der personellen und materiellen Ausstattung nicht abgebildete und fest etablierte Forschungsstruktur. Die umfängliche Arbeit aus der AG Forschung der ARCHIS beschreibt dies nochmals sehr treffend [21].
Die Notwendigkeit von Forschungsaktivitäten begründet sich umgekehrt aber aus dem Anspruch einer hohen Qualität und stetigem Fortschritt im Bereich der Einsatzchirurgie. Da jedoch wissenschaftliche Fragstellungen zu diesem Feld verständlicherweise in den zivilen Forschungseinrichtungen nicht oder nur in geringem Maße bearbeitet werden, muss hier weiterhin eine erhebliche Eigeninitiative des Sanitätsdienstes gefordert und gefördert werden.
Da abschließend verschiedene Aspekte eine entsprechende Bedeutung für die aktuelle Situation zu haben scheinen, wird zusammenfassend zur Optimierung der Forschungssituation in der Chirurgie der Bundeswehr die Frage wichtig sein, wie man Forschung zukünftig innerhalb des Sanitätsdienstes organisieren und ausrichten möchte, und welche Rahmenbedingungen man interessierten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen kann.
Von etablierten Strukturen lernen
Zur Beantwortung dieser Fragen lohnt ein Blick in die Strukturen entsprechender forschungsaktiver ziviler Einrichtungen bzw. der Fachgesellschaften. Daraus können verschiedene Lösungsansätze abgeleitet werden [20, 22 - 24].
Ein möglicher Ansatz könnten z.B. Forschungsrotationen in entsprechende Einrichtungen sein, so dass neben den damit geschaffenen organisatorischen Rahmenbedingungen vor allem auch zeitliche und damit dann auch gedankliche Freiräume für Forschung und Wissenschaft entstehen. Zudem könnte man bei diesem Modell von bereits vorhandenen Strukturen profitieren und auch eine entsprechende Anbindung und Anleitung erfahren. Ergänzend bestünde so eine hervorragende Möglichkeit, Netzwerke und Kooperationsmodelle aufzubauen und somit später die Fortführung der Arbeit an der eigenen Klinik zu erleichtern. Beispielhaft sei hierzu aus dem Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie auf das sog. „Homburger Modell“ verwiesen [24]. Im Rahmen dieses Programms an der Universität des Saarlandes soll jungen interessierten Kolleginnen und Kollegen schon während des Studiums durch eine strukturierte Anleitung und Ausbildung die Möglichkeit gegeben werden, zeitnah eine Promotionsarbeit abzuschließen und übergangslos im Anschluss, neben der klinischen Ausbildung zum Facharzt, auch die Voraussetzungen für die Habilitation zu erreichen. Dabei spielt der Aspekt eines intensiven Mentoring eine wesentliche Rolle [24]. Das vorgestellte Modell ist sicher beispielgebend und erfordert eine hochwertige und zielgerichtete Ausrichtung, eine Übertragung auf die Strukturen bei der Bundeswehr wäre jedoch sicher möglich und auch für den Bereich Forschung und Wissenschaft belebend. Aber auch bereits kleinere Schritte können gerade zu Beginn helfen, die Forschungsmotivation entsprechend zu beleben. Dies wäre zum Beispiel mit kurzfristigeren Hospitationen an Forschungseinrichtungen zum Erlernen einer bestimmten Methodik o.ä. zu erreichen; es könnte bereits das Angebot von forschungsfreien (Halb-)Tagen helfen, die Situation zu entspannen und dem häufig als wesentlich adressierten Aspekt des Zeitmangels entgegenzuwirken.
Gerade vor diesem Hintergrund erscheint jedoch auch die Anbindung an fachgesellschaftliche Strukturen sinnvoll, um hier z. B. Unterstützung für die eigene Forschungstätigkeit zu bekommen. Zum einen wird hier nicht selten die Teilnahme an bereits laufenden Multicenter-Studien angeboten, was dazu führt, dass gerade zu Beginn einer wissenschaftlichen Tätigkeit die Mitarbeit an etablierten Modellen und Methoden den eigenen Erfahrungshorizont deutlich erweitert und das wissenschaftliche Verständnis schult. Und es werden ebenso nicht selten Angebote zu einem entsprechenden Mentoring gemacht, das helfen kann, bereits von Beginn an die richtigen Schritte zu tun - besonders wenn an der eigenen Klinik der Bereich Wissenschaft und Forschung vielleicht nicht entsprechend belebt ist. So können frustrierende Negativerfahrungen und ein daraus resultierender Interessensverlust vermieden werden. Und abschließend darf auch hier der wichtige Aspekt einer Netzwerkbildung nicht vergessen werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) hat verschiedene Bereiche forciert, um gerade für Wissenschaft und Forschung in der Chirurgie eine entsprechende Plattform zu schaffen. Hier hat man zudem auch die Bedeutung des Nachwuchses für die zukünftige Arbeit als einen ganz wesentlichen Baustein identifiziert und wird nun vermehrt versuchen, diesen auch aktiv und gleichberechtigt einzubinden.
Deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen notwendig
Für den Sanitätsdienst stellt die „Professionalisierung“ von Forschung und Wissenschaft mit der Schaffung einer forschungskoordinierenden Stelle an der Sanitätsakademie der Bundeswehr den richtigen Weg dar. Dabei wird es, neben bereits vorhandenen Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung von Forschungsvorhaben, aber auch zunehmend um die Frage der Rahmenbedingungen gehen müssen. Und wenn man abschließend hochwertige und klinisch relevante Forschungsergebnisse generieren und auch akademische Laufbahnen fördern möchte, wird es auf Dauer unabdingbar sein, einen entsprechenden Forschungsauftrag im Aufgabenkatalog und der Struktur der BwKrhs zu hinterlegen und damit auch diesen Bereich der Medizin hier abzubilden. Dieses ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, der bereits in der nahen Zukunft die Attraktivität des „Arbeitsplatzes Bundeswehrkrankenhaus“ mitbedingen wird und als sicher wesentliches Entscheidungskriterium gerade für den gewünschten Nachwuchs bewertet werden darf.
Social Topics
Als dritter wesentlicher Aspekt im Interesse des Nachwuchses sind aktuell verschiedene soziale Themen von großem und zunehmendem Interesse. So wird gerade auf der Nachwuchsebene die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als einer der entscheidenden Aspekte diskutiert. Von politischer Seite wird dieses Thema ebenfalls zunehmend in den Fokus gerückt.
Das Problem: Die „Rush-Hour of Life“
Nach einer Umfrage des Jungen Forums der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) wurden 66 % der Befragten (730 Personen, 28 % weiblich, 72 % männlich) während der Weiterbildung Eltern, also deutlich mehr als die Hälfte aller Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten [3]. Die Möglichkeit der Kinderbetreuung ist damit ein daraus unmittelbar abzuleitender wichtiger Aspekt. Hier kann für die Bundeswehr die Eröffnung einer Kindertagesstätte, wie sie gerade aktuell am BwKrhs Ulm umgesetzt wird, sicher als Schritt in die richtige Richtung angesehen werden, da gerade in einem Fachgebiet wie der Chirurgie eine flexible und umfänglich vorhandene Kinderbetreuung ein wesentlicher Aspekt für die Berufszufriedenheit junger Kolleginnen und Kollegen ist. Nimmt man die oben angeführte Umfrage als Bezug, wird es jedoch hier nicht nur um die bloße Kinderbetreuung gehen können; vielmehr geht es auch um die Frage nach flexiblen und gut umsetzbaren Teilzeitmodellen, da eine volle Arbeitstätigkeit gerade in den ersten Lebensjahren der Kinder oft nur schwer umsetzbar ist. Hierzu konnten Depeweg et al. in ihrer Umfrage mit 674 Befragten zeigen, dass die Akzeptanz von Teilzeitmodellen und flexiblen Arbeitszeiten leider nur von 20 % als „kein Problem am Arbeitsplatz“ angegeben werden konnte; 80 % gaben an, dass diese bis dato schlecht integrierbar sei bzw. wenig Akzeptanz im Team bzw. bei der Klinikleitung finden würde [3].
Die geleistete Arbeit muss eine Anerkenntnis finden
Aus der aktuellen Erhebung zu einem Meinungsbild des Nachwuchses in der Unfallchirurgie und Orthopädie der Bundeswehr wurden auch noch andere Aspekte für diesen Themenbereich als wichtig und interessant bewertet. So wird beispielhaft die Notwendigkeit einer adäquaten Ausgleichsleistung für mehrgeleistete Arbeit, wie diese in der Chirurgie ja regelhaft vorkommt und notwendig ist, über z. B. entsprechende finanzielle Zusatzentgelte aufgeführt. Dabei geht es in letzter Konsequenz nicht um die abschließende Höhe dieser Entlohnung – auch wenn diese natürlich in der Tendenz entsprechenden zivilen Vergleichen standhalten muss –, sondern vielmehr um die einfache Anerkennung von mehrgeleisteter Arbeit an sich – also einfach darum, eine Feststellung zu treffen, dass mehr als eigentlich gefordert gearbeitet wurde, und dass dies geschätzt wird. Dies steht aktuell jedoch teilweise noch in einem erheblichen Widerspruch zur realen Situation, in der zum Jahressende bis dahin nicht kompensierte „Überstunden“ zum großen Teil einfach gestrichen werden, oder in der es nach aktuellen Regelungen gut möglich ist, Bereitschaftsdienste, welche vor allem auf Ebene der erfahrenen Fach- und Oberärzte oder in kleineren Fächern abgeleistet werden, abzurechnen. Fordernde Präsenzdienste auf Ebene der Assistenzärztinnen und -ärzte werden durch die aktuell gültigen Regelungen nicht adäquat berücksichtigt bzw. ausgeglichen – ein aus Sicht des Nachwuchses ganz wesentlicher Aspekt in der Wahrnehmung und Wertschätzung des Geleisteten durch den „Arbeitgeber“. Es scheint also generell eine subjektiv empfundene „Work-Life-Balance“ an Bedeutung zu gewinnen, nicht berücksichtigte Mehrarbeit wird zunehmend hinterfragt und auch der Anspruch nach adäquatem Ausgleich formuliert.
Besonderheit des Sanitätsdienstes: Planungssicherheit und Aufstiegschancen
Für den Sanitätsdienst kommt im Vergleich zum zivilen Bereich noch ein weiterer Aspekt deutlich zum Tragen, nämlich eine als sehr wichtig empfundene Planungssichersicherheit. Dabei geht es dem befragten Nachwuchs in der Bundeswehr einerseits um sichere Zusagen für die Tätigkeit im Heimatland, mit z. B. einer entsprechend langfristigen und gemeinsam geplanten Standortzusage, sowie für die Einsatzsituation um eine verträgliche Einsatzdauer bei regelhafter Einsatzfrequenz. Hier wird entsprechend der aktuellen Umfrage die aktuelle Situation mit einer durchschnittlichen Dauer von sechs Wochen Einsatz in 18 Monaten als durchweg akzeptabel angesehen und empfunden.
Ebenso abzuleiten aus dieser Umfrage sind als weiterer wesentlicher Aspekt die Aufstiegschancen, die ebenso als sehr relevant bewertet werden. Die doch sehr geschlossenen Strukturen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, gerade im klinischen Bereich, ermöglichen dabei nicht immer den zeitgerechten Aufstieg. Es wird es zum Beispiel gerade im Hinblick auf die entsprechende Dienstgraddotierung oft als unbefriedigend empfunden, wenn trotz fachlicher Qualifikation und entsprechend langer Stehzeit eine Beförderung, hier gerade vom Oberstabsarzt zum Oberfeldarzt, nicht erfolgen kann. Hier wünschen sich nicht wenige Kolleginnen und Kollegen eine entsprechende Anpassung an die klinischen Organisationsstrukturen, um somit auch eine z. B. mögliche Unterscheidung zwischen Assistenzarzt [Besoldungsgruppe A14] und Facharzt [Besoldungsgruppe A15] und in der Konsequenz dann folgend auch für die Ebene der Oberärzte herbeizuführen und zum Ausdruck bringen zu können.
Es bleibt abschließend natürlich differenzierend festzuhalten, dass sich durch die besonderen Bedingungen und Vorgaben der Bundeswehr das Eine oder Andere sicher in erster Linie nach den Erfordernissen der z. B. politischen Lage, der Entwicklung des Auftrags und der notwendigen Sicherstellung der Einsatzbereitschaft richten müssen, sich daher Notwendigkeiten ergeben, die nicht in allen Belangen die Lösung der angeführten Aspekte und Probleme zu 100 % möglich machen wird. Aber es wird um einen Konsens gehen müssen, da der Nachwuchs letztgenannten Aspekten einen immer höheren Stellenwert beimessen wird. Und dieses ist in weiten Teilen sicher auch - zumindest im Vergleich mit dem zivilen Bereich - berechtigt.
Fazit
Die Bundeswehr, und dabei insbesondere der Sanitätsdienst, werden sich zunehmend im Wettbewerb um gutes und qualifiziertes Personal bemühen müssen, Angebote zu machen und Voraussetzungen zu schaffen, die entsprechend attraktiv sind. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass für die meisten Berufsgruppen im Allgemeinen und für die Chirurgie im Speziellen der zivile Vergleichsmarkt derzeit und wohl auch längerfristig hervorragende Chancen und Möglichkeiten bietet. Die Ressource Personal wird auch zukünftig weiter der bestimmende Faktor für den Erfolg einer Institution oder Einrichtung sein, so dass es lohnenswert erscheint, diese Ressource zu pflegen und in diese zu investieren.
Literatur
- Münzberg M, Perl M, Depeweg D: Junges Forum der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 6-7
- Perl M, Stange R, Niethard M, Münzberg M: Weiterbildung im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 10-14
- Depeweg D, Achatz G, Liebig K, Lorenz O: Der junge Arzt zwischen Beruf und Familie - Status quo und Lösungsansätze im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 15-20
- Niethard M, Donner S, Depeweg D, Bode G, Schüttrumpf JP: Nachwuchsförderung – was können wir besser machen. Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 21-24
- Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31. Dezember 2013 - Ärzteschaft in der Generationenfalle (Datenstand: 07.05.2014): http:// www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.3.12002
- Nachwuchsmangel und Nachwuchsförderung in der Chirurgie - Eine der größten Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts (Datenstand: 01.06.2010): http://www.bdc.de/index_level3.jsp?documentid=0A309312613CE959C12577440036BEC0&form=Dokumente
- Inspekteur des Sanitätsdienstes, GOSA Dr. Nakath: Weisung Nr.1 zum einsatzbezogenen chirurgischen und nicht-chirurgisch operativen Kompetenzerwerb von Sanitätsoffizieren der Bundeswehr. 29.05.2009-
- Oberst M: Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie als „Zehnkämpfer“. Der Unfallchirurg 2011: 111[4]: 368-369
- Achatz G: Generalist oder Spezialist? Wohin soll die Weiterbildung aus Assistentensicht gehen? DGU Mitteilungen und Nachrichten 2011: 63: 103-104
- Friemert B, Oberst M: Generalisten in der Chirurgie – können wir wirklich darauf verzichten? DGU Mitteilungen und Nachrichten 2011: 63: 100-102
- Achatz G, Perl M, Stange R, Mutschler M, Jarvers JS, Münzberg M: Wie viel Generalist und wie viel Spezialist braucht die Orthopädie und Unfallchirurgie? Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 29-33
- Allgöwer M: Interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sicht des Chirurgen. Langenbecks Arch. Surg. 1974: 337: 801-808
- Schulenburg K: Der Generalist in der Chirurgie – no go oder must have? – Sichtweise der Politik. DGU-Vortragssitzung auf dem 129. DGCH-Jahreskongress, Berlin. 2012
- Heller KD, Kladny B, Hoffmann R: Mangel an Generalisten. OUP Congress 2013: 24.10.2013: 1
- Arbeitskreis Weißbuch der DGU: Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung / 2. erweiterte Auflage. Supplement 1. Orthopädie und Unfallchirurgie Mitteilungen und Nachrichten 2012: 9
- Stürmer KM, Raschke MJ, Burger C, Josten C, Jürgens C, Krettek C, Meffert R, Mittlmeier T, Pape HC, Marzi I: Konvent der unfallchirurgischen Lehrstuhlinhaber. Eckpunkte zur unfallchirurgischen Aufgabenstellung an den Universitäten – Strukturüberlegungen zu Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Der Unfallchirurg 2010: 113: 957-959
- White JM, Stannard A, Burkhardt GE, Eastbridge GE, Blackbourne LH, Rasmussen TE: The epidemiology of vascular injury in the wars in Iraq and Afghanistan. Ann Surg 2011: 253[6]: 1184-1189
- Rasouli MR: Epidemiology of vascular injuries in modern wars. Ann Surg 2013: 259[6]:e91
- Heldenberg E, Givon A, Simon D, Bass A, Almogy G, Peleg K: Terror attacks increase the risk of vascular injuries. Front Public Health 2014: 2: 47
- Stange R, Perl M, Münzberg M, Histing T: Vereinbarkeit von Wissenschaft und Klinik – zwischen Realismus und Utopie. Der Unfallchirurg 2013: 116[1]: 25-28
- Back DA, Palm HG, Willms A, Westerfeld A, Hinck D, Schulze C, Brodauf L, Bieler D, Küper MA, AG Chirurgische Forschung des ARCHIS bei der DGWMP: Evaluation des Forschungsinteresses unter chirurgisch tätigen Sanitätsoffizieren der Bundeswehr. Der Chirurg: eingereicht zur Publikation.
- Ahn J, Donegan DJ, Lawrence JT, Halpern SD, Mehta S: The future of the orthopaedic clinician scientist: part II: Identification of factors that may influence orthopaedic residents’ intent to perform research. J Bone Joint Surg Am 2010: 92[4]: 1041-1046
- Claes LE: Entwicklung und Perspektive der unfallchirurgischen Forschung in Deutschland. Der Unfallchirurg: 2009: 112[12]: 1079-1084
- Menger MD, Laschke MW: Chirurgische Forschung in Deutschland. Der Chirurg: 83[4]: 309-314
Beitragsbild: Martin Büdenbender/pixelio.de
Datum: 15.02.2015
Quelle: Wehrmedizinische Monatsschrift 2014/12