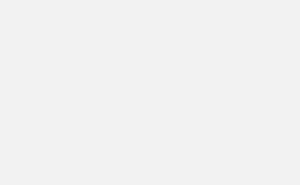SANITÄTSDIENST IM STELLUNGSKRIEG - BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN AN HYGIENE, GESUNDHEITSVORSORGE UND VERWUNDETENVERSORGUNG
Aus der Sanitätsakademie der Bundeswehr, München (Kommandeurin: Generalstabsarzt Dr. E. Franke)
V. Hartmann
Zusammenfassung:
Der vor allem im Westen prägende Stellungskrieg stellte die beteiligten Sanitätsdienste vor große Herausforderungen in den Bereichen Organisation der Feldhygiene, Präventivmedizin und Verwundetenversorgung.
Es galt im Zeitalter der Massenheere über Jahre Infektionskrankheiten abzuwehren, die durch neuartige Waffenwirkung verursachten Verwundungen einer suffizienten Versorgung zuzuführen und eine Rettungskette sicherzustellen. Dabei waren die Betroffenen heute kaum glaublichen Traumatisierungen unterworfen.
Schlagworte: Erster Weltkrieg, Grabenkrieg, Versorgung von Verwundeten, Feldhygiene, Präventivmedizin, Verwundung, Traumatisierung, Sanitätsdienst.
Summary
The Western Front was dominated by the typical trench warfare which posed major challenges to the medical services on both sides in organizing field hygiene, preventive medicine and medical treatment of the wounded. In the era of mass armies, prevention of infectious diseases, effective management of injuries and ensuring a comprehensive rescue chain was of eminent importance. Military personnel of those days were exposed to terribly traumatizing situations which are hard to imagine today.
Keywords: Great War, trench warfare, treatment of wounded, field hygiene, preventive medicine, injury, trauma, medical service.
Am Anfang des Krieges
Fünf Wochen nach Kriegsbeginn, ab dem 9. September 1914, zogen sich die Spitzen der deutschen Truppen aus ihren Brückenköpfen über die Marne nach Norden zurück. Dort bezogen sie neue rückwärtige Stellungen hinter der Aisne. Bis dahin waren die deutschen Armeen nahezu ununterbrochen bis zu 40 km am Tag kämpfend durch Belgien und den Norden Frankreichs marschiert. Der von dem deutschen Generalstab nach dem Schlieffen-Plan vorgenommene rasche Bewegungskrieg mit dem Ziel der Vernichtung des Gegners durch dessen Umfassung, der Sichelschnitt, war gescheitert. Genauso wie auch alle anderen schnellen Angriffsunternehmungen der am Krieg beteiligten Nationen im Jahre 1914 scheitern sollten.
Während der Angriffsunternehmen der ersten Kriegswochen hatten die beteiligten Truppen auf beiden Seiten ungeheure Verluste erlitten. An einem einzigen Tag, dem 22. August 1914, verloren 27 000 französische Soldaten ihr Leben.
Der schnelle Vormarsch stellte die Versorgung der Truppe vor große Herausforderungen und auch die sanitätsdienstliche Betreuung in der Bewegung war ein schwieriges Unterfangen, noch dazu in Anbetracht hoher Verwundetenzahlen.
Nun erstarrte die Front, man grub sich ein und verschanzte sich im Lehmboden Nordfrankreichs. Ein tiefgestaffeltes, sich teilweise über mehrere Kilometer breit hinziehendes Stellungssystem mit Schützengräben, Stacheldrahtsicherungen, vorgelagerten Sappen, einbetonierten Maschinengewehrstellungen und massivem Einsatz aller Arten von Artillerie wurde von der Kanalküste bis ins Elsass geschaffen. Aus ihm heraus ließ sich in der Defensive erfolgreich agieren. Eigene und gegnerische Angriffe wurden zumeist blutig unter hohen Verlusten in unzugänglichen Trichterfeldern abgeschlagen. Im Westen blieb dieser Grabenkrieg über vier Jahre die bestimmende Größe des Kampfes, aus der festen Front heraus ließ sich trotz größter Anstrengungen, wie zum Beispiel in der Champagne, an der Somme oder bei Verdun, nicht mehr zu einem entscheidenden Bewegungskrieg kommen.
Die Kriegführung
Der im Februar 1916 begonnene deutsche Angriff auf das Festungssystem um Verdun gilt bis heute als Metapher eines sinnlosen Abschlachtens Zehntausender auf engstem Raum. Aus dem Schrecken dieser „Blutmühle“ resultierte ein unbeschreibliches Leiden der Soldaten beider Seiten. Die Zeitgenossen erlebten dies in traumatischer Weise und versuchten die Geschehnisse in erschütternden künstlerischen und literarischen Zeugnissen zu verarbeiten (Abb. 1). Mit einem nie gesehenen Artillerieeinsatz regneten über Wochen stündlich bis zu 10 000 Geschosse auf die Gräben und Angriffsflächen. Der als Beratender Internist eingesetzte Berliner Charité-Professor Wilhelm His (1863 - 1934) beobachtete ein solches Bombardement französischer Stellungen:„Für einige Stunden waren sie ein einziges Flammenmeer. Die Einschüsse der großen und kleinen Geschosse, die breiten blauen Flammen der Minen- und Flammenwerfer, die bunten Raketenzeichen brachen nicht ab. […] Man hätte denken müssen, keine Seele könne in diesem Nebel der Pulver- und Minengase am Leben bleiben. […] Über die Kämpfe bei Verdun und die Leiden der Truppen haben wir viele anschauliche Schilderungen von Teilnehmern …, und doch, so eindringlich sie sind, haben sie mir nicht denselben überwältigenden Eindruck gemacht wie das Anschauen dieser entsetzlichen Feuerwirkung. Dabei stand ich entfernt und verhältnismäßig sicher! Aber selbst das noch wirkte mit der Gewalt eines furchtbaren Naturereignisses“. [1, S. 117]
Hart umkämpfte höher gelegene Geländepunkte des Schlachtfeldes um Verdun mit dem Namen „Höhe 304“ oder „Toter Mann“, die eigentlich nur noch aus mehrfach umgepflügten Lehmhügeln bestanden, sind bis heute 1 000-fache Grabstätten:
„Leute lagen in den Granattrichtern, zwischen Leichen, die durch Granaten weiter zerfetzt wurden, Gestank, keine persönliche Hygiene möglich, kaum Nahrungsmittel, Fliegenplage, Fäkalien und Leichengestank, Trinkwasser aus Granattrichtern.“ [1, S. 662]
Wie unter derartigen Umständen immer wieder motiviert in den Kampf gezogen wurde, erscheint heute kaum nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang kann das Phänomen der psychischen Verarbeitung solcher Schrecknisse, mit dem sich seither Psychoanalytiker und Sozialwissenschaftler befassen, hier nur am Rande betrachtet werden. Beobachtet wurden im Kriege alle Momente von Todesangst mit resultierenden psychischen Alterationen schwerster Ausmaße („shell shock“) bis hin zum Gegenteil, absoluter Todesverachtung und Aufbau von Parallelwelten mit raumsprengender Irrealität.
Das Wirken der Sanitätsdienste in der Mondlandschaft um die Forts Douaumont und Vaux stellte dabei durchaus einen humanitären Anachronismus in dieser gnadenlosen Welt der Materialschlacht dar:
„Das ganze Gelände südlich Fort Douaumont […] war wie ein von unzähligen Granaten zerpflügtes Feld, in dem es weder Weg noch Steg gab. Das Zurücklegen des Weges von und nach der Stellung war schon für den einzelnen Mann eine große körperliche Anstrengung, wieviel mehr für die Krankenträger, die nichtmarschfähige Verwundete zurücktragen mußten.“ [2, S. 657]
Diese Art von Kriegsführung forderte alle Ressourcen, eine Mobilisierung der Gesellschaften in ihrer Tiefe. Der Krieg hatte sich zu einer ideologisch motivierten Technisierungs- und Industrialisierungsoffensive entwickelt, einer Materialschlacht, in der sich das einzelne Individuum verlor.
Dies machte auch vor dem Sanitätsdienst und seinen Protagonisten nicht halt, denn erstmals in der Geschichte wurde zumindest durch die beteiligten Nationen auf dem westlichen Kriegsschauplatz ein tiefgegliedertes und durchaus effizientes sanitätsdienstliches System etabliert. Trotz stärkster Waffenwirkung und teilweise infernalischen Bedingungen an der Front hatten Verwundete eine große Chance zu überleben, wenn auch oft zu einem hohen Preis.
Das Stellungssystem
An der Einrichtung des ausgeklügelten Grabensystems wurde im Laufe der Jahre ständig gefeilt. Bauhygienische Aspekte des Stellungsbaus nahmen eine immer größere Bedeutung ein. Es galt nicht nur, eine möglichst sichere Deckung gegen gegnerische Waffenwirkung zu erreichen, sondern die Soldaten sollten dort auch bei schlechter Witterung einigermaßen erträglich leben. Neben Schlafunterkünften und Aufenthaltsräumen waren Küchen und sanitäre Anlagen zu errichten. Entscheidend waren bei dem Bau von Stollen und Unterständen die Deckung gegen die Einwirkung von Waffen, die Verhinderung von Bodenfeuchtigkeit und eine ausreichende Ventilation in den tiefliegenden Unterständen. Die Gräben selbst zogen sich teilweise in dreifacher Mannstiefe unter dem Bodenniveau hin, die Soldaten stiegen auf Leitern bis zu dem oben liegenden Schartensystem, mit dem Sturmangriffe abgewehrt wurden. Der Aushub wurde an der rückwärtigen Grabenseite zur Sicherung durch Maschinengewehrstellungen verwendet.
Der Sanitätsunteroffizier Clemens Bedbur schilderte die Stellung seines Infanterieregiments in der Champagne:
„Unsere Kampfstellung hat die Form eines Hufeisens und drum herum liegt der Franzose. Zur Stellung führen verschiedene Laufgräben, von denen der Schmidtweg am meisten begangen wird – aber auch der gefährlichste ist. […] Am Anfang […] liegt immer eine Kompanie in Reserve in kleinen Unterständen. Verschiedene Maschinengewehrnester sichern das vorliegende Tal. Wenn der Schmidtgraben zu Ende ist, kommt man rechts und links zum Umgehungsgraben. Kleine Gräben führen nach vorne zur zweiten Stellung oder Aufnahmestellung genannt, falls die erste Stellung verloren geht. Von hier aus geht es zur ersten Stellung oder Kampfstellung. Im Umgehungsgraben liegt der Batl. Gefechtsstand, etwas weiter in einem kleinen Graben liegt der Sanitätsunterstand bestehend aus 3 Unterständen für den Arzt, die Krankenträger und die Verwundeten. Diese […] sind durch einen Stollen miteinander verbunden. […] In unserem Sanitätsstand steht ein Operationstisch. Große Mengen Verbandstoffe.“ [3, S. 67f.]
Ein ausgeklügeltes System von Sickergräben und -schächten diente der Entwässerung in den Stellungen und Unterständen, mehr oder weniger erfolgreich. Zur Verhinderung von Tropfwasser an Decken und Wänden wurden Wellblechplatten, Zeltbahnen und Dämmmaterialien in den Bunkern und Stollen eingebaut. Besonders auf britischer Seite litten die Soldaten im Winter 1915 in Folge der feuchten und kalten Gräben an dem berüchtigten „trench foot“. Colonel Arthur Lee (1868 - 1947), sanitätsdienstlicher Berater des britischen Oberbefehlshabers, Lord Herbert Kitchener (1850 - 1916), berichtete diesem von 2 000 Soldaten einer Division, die innerhalb von einer Woche mit diesem Krankheitsbild abgelöst werden mussten:„This loss, of trained and seasoned soldiers, was sufficiently sensational to compel general attention and now prevention of ‘frozen feet’ had become the problem of the hour” [4, S. 128]
Auch die Trinkwasserversorgung stellte die Truppe vor große Herausforderungen. In den Batteriestellungen standen Wasserbehälter zur Verfügung, bei Offensiven gab es Extra-Rationen von bis zu 2,5 Litern. In den vorderen Gräben legte man Zisternen an, die sich mit Wasserfässern oder -säcken befüllen ließen. Teilweise gab es Wasserleitungen. Gegen die Verkeimung wurde Chlorkalk und Thiosulfat genutzt. Hinter der Front begutachteten chemische Untersuchungsstellen Trinkwasser, Milch, Nahrungsmittel, führten sie mikrobiologische und toxikologische Untersuchungen durch. Korpshygieniker tauchten auf und untersuchen die Unterkünfte, Vorratslager, Küchen und sanitären Einrichtungen.
Trotzdem muss das Leben für die Soldaten in den vorderen Linien, abgesehen von den ständig drohenden Feuerüberfällen, auch durch die Unbill der Naturgewalten äußerst belastend gewesen sein. Ernst Jünger, Stoßtruppführer an diversen Frontabschnitten, berichtete:
„In der Nacht stürzten nach einem Wolkenbruch sämtliche Schulterwehren ein und verbanden sich mit dem Regenwasser zu zähem Brei, der den Graben in einen tiefen Sumpf verwandelte. Der einzige Trost war, daß es dem Engländer auch nicht besser ging, denn man sah, wie aus seinen Gräben eifrig Wasser geschöpft wurde. Da wir etwas erhöht liegen, pumpten wir ihm unseren Überfluß noch herunter. […] Die herabstürzenden Grabenwände legten eine Reihe von Leichen aus den Kämpfen des vorigen Herbstes bloß.“ [5, S. 54f.]
Die Hygiene in den oft verschlammten Schützengräben erforderte ein strenges Reglement. Ratten und anderes Ungeziefer aller Art waren ungebetene Gäste. Erich Maria Remarque schilderte:
„Die Ratten haben sich sehr vermehrt in der letzten Zeit […] sind besonders widerwärtig, weil sie so groß sind. Es ist die Art, die man Leichenratten nennt. […] Sie scheinen recht hungrig zu sein. Bei fast allen haben sie das Brot angefressen.“[6, S. 92]
Zudem machte die Verlausung der Truppe, die in den engen und feuchten Unterkünften hauste, wie auch der Flohbefall zu schaffen:
„Mein Stollen war tief und tropfig. Er hatte eine Eigenschaft, die mir wenig Freude machte: es kamen nämlich in dieser Gegend statt der üblichen Läuse die viel beweglicheren Verwandten vor. Die beiden Arten stehen anscheinend in demselben feindschaftlichen Verhältnis zueinander wie Wander- und Hausratte. Hier half nicht einmal der gewohnte Wäschewechsel, denn die sprunggewandten Schmarotzer lauerten tückisch im Stroh der Lagerstätte. Der zur Verzweiflung getriebene Schläfer riß endlich die Decken heraus, um eine gründliche Treibjagd zu veranstalten.“ [5, S. 187]
Um die Verlausung und resultierende Infektionskrankheiten zu bekämpfen, wurden auf Divisionsebene professionelle Bade-, Wasch- und Entlausungsstationen eingerichtet, in denen Soldaten wie auch Kriegsgefangene sich regelmäßig waschen konnten, um ihre persönliche Hygiene sicherzustellen.
Gesundheitszustand
Der Gesundheitszustand der Soldaten in den Gräben schwankte ständig, über Tage ernährte man sich in den vorderen Stellungen von kalter Büchsenkost und regendurchnässtem Brot.Neben diversen dermatologischen Problemen traten daher Magendarmkrankheiten in großer Zahl als „Geißel des Heeres“ [7, S. 156] auf, auch in Folge der Anstrengungen, so dass nachlassende Physis und Psyche der Kämpfer einen ständigen Wechsel der Fronttruppe erforderte, um sich in Ruheunterkünften, Waldlagern oder Ortschaften weiter hinten zu erholen. Im Gegensatz zu den Fronten im Osten oder in der Türkei spielten Infektionskrankheiten ansonsten im Grabenkrieg des französischen Kriegsschauplatzes nur eine geringere Rolle. Eine gewisse Bedeutung besaßen hier Erkrankungen der Atemwege wie Lungenentzündungen und solche des typhösen Formenkreises. Diese machten es notwendig, eine strikte Latrinenhygiene einzurichten, Dauerausscheider zu identifizieren sowie aus dem Frontgebiet zu entfernen und spezielle Seuchenlazarette im rückwärtigen Bereich einzurichten. Erst die konsequente Durchführung der neuen Schutzimpfung brachte Besserung. Auch die Tuberkulose, die verschiedenen Geschlechtskrankheiten in der Etappe und ab Sommer 1918 auch die Grippe, die sich seuchenartig aus Amerika kommend bei Soldaten und Zivilisten aller kämpfenden Parteien ausbreitete, beschäftigten die Sanitätsdienste. Allein im Juni/ Juli 1918 erkrankten etwa 540 000 vornehmlich jüngere deutsche Soldaten an der Grippe.
Besonders bei den alliierten Truppen ist das durch Läuse übertragene sogenannte Fünftage- oder Schützengrabenfieber (Trenchfever) bekannt geworden, das mit schweren grippalen Symptomen einherging. Auf deutscher Seite beschäftigten sich viele Wissenschaftler mit der durch Kälte verursachten Kriegsnephritis, die einige Ausfälle verursachte. Die Ursache, Infektionen mit Hanta-Viren, war in der damaligen Zeit noch nicht bekannt.
Für die Soldaten wirklich gefährlich waren in Folge ihrer hohen Mortalität die vornehmlich im Nahen und Mittleren Osten beobachtete Cholera und das gefürchtete Fleckfieber, welches vor allem an der russischen Front bei Kriegsgefangenen auftauchte. Hier galt es, ein striktes präventivmedizinisches Konzept, vor allem in Hinsicht auf die Läusebekämpfung, zu entwickeln.
Im weiteren Verlauf sank die Letalität an Infektionskrankheiten auch auf Grund der bedeutenden Fortschritte in der Bakteriologie im Vergleich zu früheren Kriegen deutlich. So betrug das Verhältnis zwischen Gefallenen bzw. an Wunden verstorbenen Soldaten zu solchen, die durch Krankheiten verstarben, auf deutscher Seite 1 zu 0,1. Im Kriege 1870/71 waren statistisch auf einen Gefallenen noch 1,4 an Krankheiten umgekommene Soldaten gekommen.
Sanitätsdienstliche Versorgung
Die Bergung auf dem Schlachtfeld
Die Verwundetenversorgung während des Stellungskrieges basierte auf einem abgestuften System. Dessen schwierigste und gefährlichste Komponente lag dabei am Anfang: Bei der Bergung der Verwundeten der Sturmangriffe, die zum Teil noch Tage in den Trichterfeldern des Niemandslandes lagen, musste die Deckung verlassen werden (Abb. 2). Das Sanitätspersonal und die Krankenträger der Bataillone leisteten bei der Erstversorgung und Bergung Übermenschliches, oft im Kugelhagel oder unter Artilleriebeschuss in unwegsamem Gelände. Man nutzte hierzu eine Vielzahl von oft einfachen Tragesystemen:
„Ich wurde auf eine Zeltbahn gelegt, durch deren Schnüre man einen jungen Baum steckte, und vom Schlachtfeld getragen.“[5, S. 184]
Die Verluste unter den Krankenträgern waren dabei besonders hoch, da sie ungeschützt die Verwundeten nach hinten tragen mussten. „Den Sanitäter der Sechsten, der das Hinterende meiner Zeltbahn gefasst hatte, riß ein Kopfschuss zu Boden; ich stürzte mit ihm.“[5, S. 293] Bei Verdun waren die Verluste an Krankenträgern so enorm, dass auch die Musiker, Mannschaften aus den Rekrutendepots, gefangene Franzosen unter ständigem Wechsel zwischen Ruhe und Dienst als Sanitäter eingesetzt wurden. Immerhin schienen auch in diesem Umfeld doch gewisse Regeln des Kriegsrechts eingehalten worden zu sein. Immer wieder schilderten Zeugen, dass einzelne Krankentragen mit Verwundeten, wenn sie die Rotkreuz-Flagge trugen, nicht durch Schützen beschossen wurden.
Erste Sanitätsdienstliche Versorgung
Zu Beginn des Angriffes auf die französischen Linien vor Verdun hatte der deutsche Feldsanitätschef sanitätsdienstlich durchaus vorgeplant: Jeder Angriffsdivision waren zwei Sanitätskompanien zugeordnet, 21 000 Betten standen für Verwundete in Feld- und Kriegslazaretten bereit. Zum Verwundetentransport in die rückwärtigen Sanitätseinrichtungen hatte die zuständige Etappen-Sanitätskraftwagenabteilung eine bislang nicht gekannte Zahl motorisierter Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen: 242 SanKraftwagen, 59 Omnibusse, 27 PKW und 66 Anhänger waren für den Verkehr zwischen den Hauptverbandplätzen (HVPL), Feldlazaretten und Kriegslazaretten vorgesehen. Außerdem wurden Schienenwagen, sogenannte Benzolbahnen, weit nach vorne verlegt und Eisenbahnzüge für die Verbringung in die Heimat bereitgestellt.
In einem Front-Infanteriebataillon befanden sich gewöhnlich ein (Ober)-Stabsarzt und ein Ober- bzw. Assistenzarzt. Eine Infanteriekompanie verfügte über einen Sanitätsunteroffizier und vier Krankenträger. Man agierte in einem Truppenverbandsplatz, der möglichst gegen Artillerie- und Infanteriegeschosse geschützt als eine Art Sanitätsbunker in einem Grabenstück nahe der vordersten Linie lag:
„Es dunkelte bereits, als zwei Krankenträger, die das Gelände absuchten, vorbeikamen. Sie luden mich auf ihre Bahre und trugen mich in einen mit Stämmen gedeckten Sanitätsunterstand, in dem ich die Nacht verbrachte, eng zusammengedrängt mit vielen Verwundeten. Ein abgespannter Arzt stand mitten im Gewühl stöhnender Menschen, verband, machte Einspritzungen und gab mit ruhiger Stimme Anweisungen.“ [5, S. 3]
In diesen Einrichtungen ließen sich zumindest die Erste Hilfe oder auch Verbände bis hin zu Notamputationen bewerkstelligen. Bei schweren Angriffen und zerstörerischem Artilleriefeuer auf die vorderen Linien waren auch die Bataillonsärzte mit Rettungsaufgaben beschäftigt. Der später mit der höchsten baye - rischen Tapferkeitsauszeichnung für Sanitätsoffiziere, dem Bayerischen Militär-Sanitäts-Orden, ausgezeichnete Stabsarzt Dr. Rudolf von Heuß (Abb. 3),
„ trug [...] teilweise persönlich, [...] rettete aus eingestürzten Mauern und Kellern wiederholt verschüttete, grub [...] und barg die Leichen zweier fast völlig vernichteten Bataillonsstäbe [...] während alles um hin herum zusammenstürzte [...]. Am 22. Oktober 1916 verliess Dr. v. Heuß als letzter die Reste des Gefechtsstands […] [und] hatte […] ohne Schlaf und warme Verpflegung den täglichen Durchgang von etwa 120 Verwundeten geleitet und in einer wahren Hölle unerschütterlich ausgeharrt.“ [9, S. 55]
Mitten auf dem Schlachtfeld der Verdun-Front bot ein tief im betonierten Fort Douaumont gelegener und für 120 Verletzte ausgelegter Truppenverbandplatz einen gewissen Schutz für die Verwundeten. Diese Krankenunterkunft besaß, mit elektrischem Licht, Handlüftern und Telefonen nach rückwärts versehen, fünf Räume, einen Verbandraum mit sechs Tischen, den Warteraum, eine Kammer für 20 Schwerverwundete, den Stollen für 80 Leichtverwundete und den Unterkunftsraum für den Fortarzt, einen Chirurgen einer Sanitätskompanie mit zahlreichen Sanitätsunteroffizieren, 24 Krankenträgern und einigen Militärkrankenwärtern. Alle zehn Tage wurde diese Truppe des 1. Bayerischen Armeekorps abgelöst.
Vom Truppenverbandplatz aus galt es nach der Erstversorgung den nicht minder gefährlichen Transport nach hinten zu organisieren. Krankenträger verbrachten die Verwundeten mit Krankenwagen der Sanitätskompanie, anderen Leerfahrzeugen oder auch mit eigener Kraft zum Hauptverbandplatz. Dieser lag gewöhnlich etwa 5 - 8 km hinter der vorderen Linie, also noch in Reichweite der gegnerischen Artillerie. Vor Verdun transportierten die Angehörigen der beiden Sanitätskompanien der 1. Bayerischen Infanteriedivision im Frühsommer 1916 dreimal täglich die Verwundeten von den Truppenverbandplätzen auf lehmigen, von unzähligen Granatlöchern aufgewühltem Boden im Feuer bis zu dem vorgeschobenen Hauptverbandplatz, was im günstigen Fall Stunden dauerte.
Auf den Hauptverbandplätzen und in den Feldlazaretten
„Auf dem Hauptverbandplatz lag [...] für die Frischverwundeten der kriegschirurgische Schwerpunkt.“[10, S. 2]
Es war der erste Behandlungsplatz, in dem – wenn auch noch unter Frontbedingungen – operiert werden konnte. Von hier aus ging es zu den Feldlazaretten, jede Division besaß davon drei. Sie waren für eine stationäre Behandlung von etwa 200 Patienten ausgelegt, Fachärzte verschiedener Disziplinen standen bereit, die in operativen Einrichtungen Arbeiten mit Röntgenmöglichkeit verrichten konnten, gestützt auf Desinfektoren, Trinkwasseraufbereitungssysteme und Feldküchen. Gerne genutzt wurden für Hauptverbandplätze und Feldlazarette ortsfeste Einrichtungen, zum Teil Schulen oder Kirchen, in denen rund um die Uhr operiert wurde und sich für die Beteiligten furchtbare Szenen abspielten (Abb. 4). Der Sanitätsunteroffizier Bedbur berichtete über einen Hauptverbandplatz in der Kirche von Ripont:
„Im rechten Seitenschiff war eine Vorrichtung mit 30 Waschschüsseln […], im linken Seitenschiff waren sechs Brausebäder. In dem Mittelschiff lagen sterbende Kameraden und röchelten und kämpften sich hinüber und am Altar las der Priester die Hl. Messe.“[3, S. 70]
Besonders an Großkampftagen wurden die Hauptverbandplätze und Feldlazarette mit Hunderten von Verletzten überflutet. Ärzte und Pfleger arbeiteten rund um die Uhr bis zur Erschöpfung, um Patienten zu stabilisieren und rasch weiter nach hinten in die Kriegslazarette abzusteuern. Ernest Hemingway (1899 - 1961) verarbeitete literarisch seine Erlebnisse als Sanitäter an der italienischen Front:
„Draußen im Dunkel vor dem Verbandplatz lagen eine Menge von unseren Leuten auf der Erde. Man trug Verwundete hinein und heraus. Ich konnte das Licht aus dem Verbandsraum dringen sehen, wenn der Vorhang beiseite geschoben wurde, um jemand herausoder hineinzutragen. Die Toten lagen alle auf einer Seite. Die Ärzte arbeiteten mit bis zu den Schultern aufgekrempelten Ärmeln und waren rot wie die Schlächter.“[11, S. 71]
Auf deutscher Seite halfen zehntausende Rotkreuzschwestern, in zweimonatigen Schnellkursen ausgebildet. So schilderte die 18jährige Rotkreuzfreiwillige Helene Fischer diese Momente in ihrem Lazarett im Elsass:
„Die Verbände sind durchgeblutet, oft verkleistert. Uniformen, gar Stiefel auszuziehen bedeutet ein Kunststück. Es stöhnt und wimmert überall. Wir kommen nicht mehr zur Besinnung.“[12, S. 162]
Der berühmte österreichische Schriftsteller und Reserveoffizier Robert Musil (1880 - 1942) schrieb über seine Eindrücke beim Besuch eines Lazaretts:
„50 Menschen in dem nicht großen Raum. Ärzte und Schwestern in weißem Kittel, nackt, halbnackt bekleidete Kranke. Erfrorene Füße, aufgedeckter Steiß, Schenkelstümpfe, verkrüppelte Arme. Um entblößte Liegen, Hin und Hereilen, Zugreifen von Instrumenten, Pinseln von Frauenhänden wie ein Abort sorgfältigen Malens, Hinaushumpeln und Hineintragen.“[13, S. 326]
Und auch der französische Dichter und Arzt Georges Duhamel (1884 - 1966), der bei Verdun in einer Ambulance chirurgicale Verwundete behandelte, versuchte das dortige Elend literarisch aufzuarbeiten:
„Manchmal gingen wir um ein stilles Bett herum, um das Anlitz eines Verwundeten zu sehen; aber wir fanden nur noch einen Toten.“ [14, S. 111]
Waffenwirkung und Verwundungen
Die hohen Verluste im Ersten Weltkrieg basierten auf dem massiven Einsatz von Maschinengewehren und Geschützen aller Kaliber. In ein solches „Stahlgewitter“ gerieten die angreifenden Soldaten ohne Möglichkeit der Deckung. Sowohl Kadenz der Maschinenwaffen als auch die Durchschlagskraft waren im Vergleich zu vorherigen Kriegen wesentlich verbessert, genauso wie die Feuerkraft, Zielgenauigkeit und Reichweite der Artillerie. Gewehrschüsse verursachten vornehmlich Verwundungen im Hals, an den Oberarmen und im Rumpfbereich. Während in den beiden ersten Kriegsjahren die zur Behandlung gekommenen Gewehrschussverletzungen noch zahlreicher als die durch Artilleriegeschosse gewesen sind, waren allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt mehr Soldaten an jenen gefallen. In den letzten Kriegsjahren nahmen die Artilleriegeschossverletzungen weiter zu und führten zu teilweise eingreifenden und verstümmelnden Verletzungen (Abb. 5). Der Leipziger Lyriker und Regimentsarzt Wilhelm Klemm (1881 - 1968) arbeitete auf einem Hauptverbandplatz an der Aisne und schrieb in einem Brief am 5. November 1914 nach Hause:
„Ich habe jetzt 3 Säle, wo heute 82 Verwundete sind. Wir bekommen hauptsächlich Beinschüsse, Hüftenschüsse, Hals- Kopf- Gesicht und Brustschüsse. Die großen Zertrümmerungen, Bauchaufreißungen, Abschüsse von Körperteilen sterben durchgehend draußen, da die Verwundeten nur nachts und auch da oft erst nach mehreren Nächten herausgeholt werden können.“[15, S. 384]
Bereits während der Marneschlacht hatten die Franzosen mit hoher Feuergeschwindigkeit und Treffgenauigkeit Schrapnellgeschosse genutzt, die verzögert explodierten und Metallkugeln über die in großen Massen anstürmenden Angreifer verschossen. Die oft kleinen Splitter waren für 2/3 der Artillerieverwundungen verantwortlich und betrafen bevorzugt den Kopfbereich. Hans Carossa (1878 - 1956), 1916 als Assistenzarzt in den Karpaten eingesetzt, berichtete über eine solche Verwundung:
„An einer Granitplatte […] lehnt G., noch atmend, aber schon ganz mit der einsichtigen Miene der Toten. Man sah kein Blut. Schmerz und Schauder zurückscheuchend, suchten wir die Wunde und fanden endlich einen feinen, in den Nacken eingedrungenen Splitter. Bald stand die Atmung still.“[16, S. 84]
Während etwa 15 % aller Verwundungen den Kopf betrafen, erlagen 50 % der Gefallenen solchen Verletzungen. Die Zahl sank erst nach der ab 1916 eingeführten Verwendung des Stahlhelms, stellte die Chirurgen in Feldlazaretten aber stets vor große Herausforderungen. Der berühmte amerikanische Neurochirurg Harvey Cushing (1868 - 1939) arbeitete bei Ypern in der No. 46 Casualty Clearing Station (Abb. 6); in seinem Tagebuch „From a Surgeon’s Journal“ schrieb er unter dem 3. August 1917:
„In the early afternoon a large batch of wounded were unexpectedly brought in – mostly heads – men who have been lying out for four days in craters in the rain, without food. It is amazing what the human animal can endure. Some of them had maggots in their wounds. Than a long operation on a sergeant with things in his brain and ventricle like the man of last night – the magnet again usefool.”[17, S. 129]
Wundinfektionen, Tetanus und Gasbrand
Ebenso machte den Chirurgen die Kontamination der Verwundungen mit Schmutz, pathogenen Keimen oder Uniformbestandteilen zu schaffen. Man beobachtete insbesondere bei schweren Minen- und Artillerieverwundungen ausgedehnte Wundinfektionen. Die einzige präventive Maßnahme bestand darin, rasch mit einem sterilen Verbandpäckchen abzudecken und den Verletzten so schnell wie möglich zur Behandlung zu verbringen. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Eintreffens stieg die Infektionsgefahr rapide und resultierend in der vor-antibiotischen Ära konsekutiv die Letalität.
Aseptische Wundbehandlungsmaßnahmen hatten daher auf allen sanitätsdienstlichen Ebenen zu erfolgen:
„Die Ärzte bemühten sich um Sterilität des Naht- und Verbandmaterials. Jodanstrich und Gummihandschuhe waren auch im Erdbunker an der Tagesordnung.“[18, S. 197]
In der chirurgischen Behandlung setzte sich im Laufe des Krieges ein aktiv operatives Vorgehen mit Anlage von Sekret-Drainagen durch, da man prinzipiell jede Granatsplitterverletzung als kontaminiert ansah. Dagegen ließen sich großflächige Friedrich’sche Wundausschneidungen mit dem Ziel der Herstellung steriler Verhältnisse an der Front kaum bewerkstelligen. Große Sorge bereiteten dabei insbesondere die Infektionen mit Anaerobiern. Bereits lange vor Kriegsbeginn hatte am 30. November 1907 der Wissenschaftliche Senat bei der Kaiser-Wilhelms- Akademie für das militärärztliche Bildungswesen die Verwendung von Tetanus-Heilserum für die vorbeugende Einspritzung bei Verwundeten empfohlen. Die Umsetzung dieser Maßnahme stockte jedoch, so dass bei Kriegsausbruch Tetanus-Antitoxin nur in rückwärtigen Depots in geringerer Anzahl eingelagert war. Den an der Front eingesetzten Sanitätstruppen stand es mithin nicht zur Verfügung. Bei einer Tetanus-Morbidität von 0,38 % aller Verwundeten in den ersten beiden Monaten des Kriegs erkrankten von den ca. 430 000 deutschen Verwundeten immerhin fast 1 700 Soldaten an Tetanus. Die Quote entsprach damit der des Krieges 1870/71, die Letalität betrug fast 70 %. Es galt nun stringent zu handeln. Empfehlungen des Feldsanitätschefs führten deshalb zu einer deutlichen Erhöhung der Produktion und Beschaffung des Antitoxins. Feldlazarette und Sanitätskompanien wurden damit ausgestattet, später auch die vorgeschobenen Verbandplätze und Truppenärzte. Bereits am 4. Oktober 1914 wurde empfohlen, bei ausgedehnten und grob verunreinigten Wunden Antitoxin zu spritzen.
„In der Silvesternacht 1914 wurden in Burcquoy eine größere Anzahl Soldaten verwundet, von denen 30 ins Lazarett Cambrai kamen, alle sofort vorbeugend Serum erhielten und keiner an Wundstarrkrampf erkrankte. Nach sieben Tagen wurde ein Soldat eingeliefert mit bereits ausgedehnten Erscheinungen eines schweren Wundstarrkrampfs; er hatte eine ganz kleine punktförmige, schon wieder verheilte Verletzung, war unter denen gewesen, die draußen geblieben und nicht gespritzt worden waren, hatte wieder Dienst gemacht und starb schon zwei Tage nach Ausbruch der Krankheit.“[ 7, S. 83f.]
Diese Beobachtung führte zu einer weiteren Verschärfung des Prophylaxeregimes und der Empfehlung, bei allen Verwundungen Tetanus- Antitoxin zu spritzen. Die Erkrankungszahlen gingen daraufhin deutlich zurück.
Bei der zweiten gefürchteten Anaerobierinfektion, dem Gasbrand, gelang während des Krieges allerdings kein durchschlagender Erfolg. Die Krankheit brach im Westen bei etwa 0,6 % aller Verwundeten aus, im Osten lag sie zum Teil bis zu 10fach höher und besaß eine Letalität von ca. 35 %. In den Lazaretten war sie äußerst gefürchtet. Wilhelm Klemm berichtete:
„Das Scheußlichste sind die sog. Gasphlegmonen, die sich im Unterarm und in der Wade am häufigsten entwickeln […] in den Muskeln entwickelt sich keine richtige Eiterung, sondern eine gasige Fäulnis […] dazu ein infernalischer Geruch […]. Bei diesen scheußlichen Phlegmonen wird jetzt […] schleunigst amputiert […] wir stehen dieser schrecklichen Krankheit machtlos gegenüber.“[15, S. 384]
Die einzige Behandlungsmethode waren somit häufig verstümmelnde Operationen. Wissenschaftlich exakte Behandlungsergebnisse des ab 1917/18 angewandten Gasbrandserums sind bis Kriegsende nicht mehr getätigt worden.
Schlussbetrachtung
Viele verletzte Soldaten überlebten ihre Verwundungen, wenn auch oft verstümmelt. Von 100 ärztlich behandelten Verwundeten wurden 94 geheilt, nur 6 starben. Im Krieg 1870/71 hatte das Verhältnis noch bei 89 zu 11 gelegen, im Krimkrieg waren 25 % aller in den Lazaretten behandelten Soldaten gestorben. [7, S. 66] Der deutsche Sanitätsbericht, der die Truppen- und Lazarettberichte in nüchterner Sprache exakt auswertete, zählte neben Millionen von Verwundungen schließlich offiziell 700 000 Soldaten, die als Dienstunbrauchbare und auf Grund von Kriegsdienstbeschädigung als verstümmelt anerkannt wurden. Davon sollen 42 000 Soldaten Verstümmelungen an den Armen erlitten und 32 000 Kriegsteilnehmer ein Bein verloren haben. An völlig Erblindeten wurden im Bericht 2 450 Männer gezählt.
„Wenn die Zahlen somit trotz der ungeheuer gesteigerten Waffen, Arten, Wirkung und Technik der Waffen die Todeszahlen des WK im Vergleich zum Kriege 1870/71, auf den gleichen Zeitraum und die Kriegsteilnehmer bezogen, nur wenig höher waren, ist dies den militärischen Schutzmaßnahmen des Stellungskriegs, der Taktik, der Gesundheitspflege und dem Fortschritt in der Medizin zu sehen.“[7, S. 14](Abb. 7)
Sinnbildlich gesprochen waren Henry Shrapnels (1761 - 1842) Stahlgeschosse auf die Blutleere-Operationen von Friedrich von Esmarch (1823 - 1908) gestoßen und Hiram Maxims (1840 - 1916) Maschinengewehre auf Ernst von Bergmanns (1836 - 1907) aseptische Operationsweise. Richard Gatlings (1818 - 1903) mehrläufige Maschinenwaffen trafen auf Wilhelm Conrad Röntgens (1845 - 1923) Strahlendiagnostik und das Gewehr von Winford Lewis (1879 - 1943) auf das Tetanus-Antitoxin von Emil von Behring (1854 - 1917).
Trotzdem ist das Leid des Einzelnen an Psyche und Physis in dieser Apokalypse bis heute unbeschreiblich.
Literaturverzeichnis:
- His W: Die Front der Ärzte. 2. Aufl. Bielefeld und Leipzig: Velhagen & Klasing 1931.
- Sanitätsbericht über das Deutsche Heer im Weltkriege 1914/1918. (Deutscher Kriegssanitätsbericht 1914/18). Bearbeitet in der Heeres- Sanitätsinspektion des Reichswehrministeriums II. Band. Der Sanitätsdienst im Gefechts- und Schlachtenverlauf im Weltkriege 1914/1918. Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1938.
- Kiegelmann F-J: Der Krieg 1914-1918. Wie ich ihn erlebte. Tagebuchaufzeichnungen des Sanitätsunteroffiziers Clemens Bedbur. o.O.: Vindobona Verlag 2012.
- Harrison M: The Medical War. British Military Medicine in the First World War. Oxford – New York: Oxford University Press 2010.
- Jünger E: In Stahlgewittern. Stuttgart: Klett-Cotta 2014.
- Remarque EM: Im Westen nichts Neues. Osnabrück 2014.
- Sanitätsbericht über das Deutsche Heer im Weltkriege 1914/1918. (Deutscher Kriegssanitätsbericht 1914/18). Bearbeitet in der Heeres- Sanitätsinspektion des Reichswehrministeriums III. Band. Die Krankenbewegung bei dem Deutschen Feld- und Besatzungsheer. Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1934.
- Bayerns Goldenes Ehrenbuch. Gewidmet den Inhabern der höchsten bayerischen Kriegsauszeichnungen aus dem Weltkrieg 1914/1918. Bearbeitet vom Bayerischen Kriegsarchiv. München: Verlag Joseph Hyronimus 1918.
- Franz C: Die Wechselbeziehungen zwischen Kriegschirurgie und Sanitätsorganisation bzw. Sanitätstaktik. In: Der Deutsche Militärarzt 1936; 1: 2-15.
- Hemingway E: In einem anderen Land. 10. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2013.
- Schomann S: Im Zeichen der Menschlichkeit. Geschichte und Gegenwart des Deutschen Roten Kreuzes. Berlin: Deutsche Verlags- Anstalt 2013.
- Musil R: Tagebücher, Bd. 1. Hrsg. von Adolf Friso. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1983.
- Duhamel G: Leben der Märtyrer 1914-1916., Zürich: Rascher 1919.
- Schubert D: Künstler im Trommelfeuer des Krieges 1914-18. Heidelberg: Wunderhorn Verlag 2013.
- Carossa H: Rumänisches Tagebuch. Baden Baden: Suhrkamp 1978.
- The Face of Mercy. A Photographic History of Medicine at War. Ed. By Matthew Naythons. New York: Random House 1993.
- Kolmsee P: Unter dem Zeichen des Äskulap. Eine Einführung in die Geschichte des Militärsanitätswesens von den frühen Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges., Bonn: Beta Verlag 1997. (= Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, 11).
Bildquellen:
Abb. 1: Der Weltkrieg im Bild, Berlin-Oldenburg 1927, S. 154
Abb. 2 - 4, 6 - 7: SanAkBw, Wehrgeschichtliche Lehrsammlung
Abb. 5: SanAkBw, Wehrpathologische Sammlung; Foto: Dr. Hartmann
Abb. 1: Nach dem Einschlag eines Artilleriegeschosses auf den Hauptverbandsplatz im Frühjahr 1918
Abb. 2: Abtransport eines Verwundeten
Abb. 3: Stabsarzt Dr. von Heuss
Abb. 4: Verwundete werden auf einen Verbandplatz gebracht.
Abb. 5: Granatsplitterverletzung des Oberschenkels Wehrpathologische Sammlung; Foto: Dr. Hartmann
Abb. 6: Der Freiburger Armeepathologe Prof. Dr. Aschoff bei der Sektion eines an schwerer Verwundung Gefallenen
Abb. 7: Verwundetenversorgung auf einem Hauptverbandplatz
Datum: 25.07.2014
Wehrmedizinische Monatsschrift 2014/7