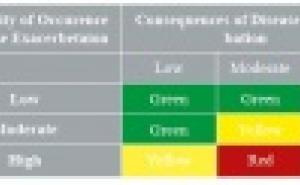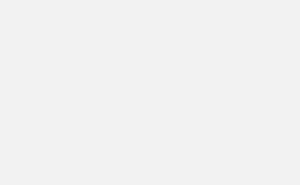HUMANITÄRE HILFE UND KAMPF
DIE BUNDESWEHR ALS GEGENSTAND DER NEUESTEN MILITÄRGESCHICHTE
Die sicherheitspolitischen und militärischen Weichen in Richtung auf Kampfeinsätze der Bundeswehr wurden in den Jahren nach der Wiedervereinigung gestellt.
Deutschland suchte nach einer neuen internationalen Rolle, schrittweise und in Reaktion auf konkrete internationale Krisen und Konflikte, aber ohne dass von vornherein ein strategisches Ziel künftiger Außen- und Sicherheitspolitik klar erkennbar gewesen wäre. Die Öffentlichkeit widmete ihre Aufmerksamkeit dem Zusammenwachsen von West- und Ostdeutschland. Dem militärischen Engagement im Ausland hingegen schenkte kaum jemand Beachtung.
Schon wenige Monate nach Erlangung der vollständigen Souveränität 1990 brach die Bundesregierung mit der Jahrzehnte lang geübten Praxis, die Bundeswehr außerhalb der NATO-Bündnisverteidigung ausschließlich für humanitäre Hilfsleistungen einzusetzen. Seit der Erdbebenhilfe im marokkanischen Agadir 1960 hatten westdeutsche Streitkräfte in mehr als 130 solcher Einsätze weltweit Anerkennung erworben. Die „Berliner Republik“ betrat nun eine neue Bühne.
Personal der ABC-Abwehrtruppe stand von 1990 bis 1991 in Jordanien, Saudi-Arabien und Katar. 1991 schützte die Luftwaffe als Teil der NATO Allied Mobile Force Europe den Bündnispartner Türkei während des Golfkriegs gegen mögliche irakische Angriffe und erfüllte dabei eine Rolle, die noch weitgehend den Denkmustern und Planungen des Kalten Krieges entsprach. Von April bis Juli räumten deutsche Einheiten vor Kuwait unter ungeklärten verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen Minen im Persischen Golf. Im kambodschanischen Phnom Penh betrieb die Bundeswehr von 1992 bis 1993 ein Krankenhaus und war damit in eine friedensschaffende internationale Mission eingebunden, ohne dass dies im Deutschen Bundestag oder gar in der Öffentlichkeit weiter thematisiert worden wäre.
Von 1993 bis 1994 schließlich kam die Bundeswehr, noch unter den Rahmenbedingungen des Auf- und Umbaues gesamtdeutscher Streitkräfte bei gleichzeitiger radikaler Truppenreduzierung, in Somalia zum Einsatz. Deutsche Heereskräfte in der Stärke von insgesamt 1 400 Mann unterstützten, weitgehend auf für den Kalten Krieg ausgelegte Strukturen angewiesen, das Engagement der Vereinten Nationen (UNOSOM II, insgesamt 28 000 Soldaten und Polizisten) in der Gegend der zentralsomalischen Stadt Belet Uen. Die Blauhelmoperation endete im Februar 1994 und verfehlte ihr politisches Ziel, im von Hunger und Bürgerkrieg gezeichneten Somalia stabile Verhältnisse zu schaffen. Deutsche Marineeinheiten erhielten den Auftrag, das Bundeswehr- Kontingent von Mogadischu aus über See nach Mombasa und Dschibuti zu evakuieren – ein bis dahin nie vorgesehener und geübter Auftrag. Erst nach Rückkehr der Heeressoldaten stellte das Bundesverfassungsgericht am 12. Juli 1994 klar, dass die Bundeswehr sich nach der Zustimmung durch das Parlament an Maßnahmen kollektiver Friedenssicherung beteiligen dürfe. Im Rückblick brachte Somalia eine wesentliche sicherheits- und militärpolitische Zäsur. Eine erfolglose Mission in Afrika läutete das Ende einer außenpolitischen Selbstbeschränkung ein, die sich die Bonner Regierungen Jahrzehnte lang selbst auferlegt hatten. Die Bundeswehr bot große Kontingente für die Einsätze in Bosnien-Herzegowina auf (UNPROFOR, IFOR, SFOR, EUFOR), war 1999 am Luftkrieg der NATO gegen Restjugoslawien beteiligt und leistete einen wesentlichen Beitrag beim Einmarsch des Bündnisses in das Kosovo und im Rahmen der 1999 etablierten Schutztruppe KFOR. 2006 sicherten deutsche Soldaten im Rahmen einer Mission der Europäischen Union Wahlen in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa, ab.
Historische Überlieferung von Auslandseinsätzen
Mehr als 20 Jahre „Armee der Einheit“ sind ein Anlass, sich des weiten Weges bewusst zu werden, den die Bundeswehr seit Kuwait, Phnom Penh und Somalia zurückgelegt hat, und die Frage nach der Identität deutscher Streitkräfte im 21. Jahrhundert zu stellen. Die neueste Militärgeschichte will diesen Wandel analysieren und greifbar machen. Auslandseinsätze als der zentrale Auftrag der Bundeswehr im beginnenden 21. Jahrhundert bilden dabei den Ausgangspunkt.
Laufende oder abgeschlossene Missionen sind zunächst in ihren militärischen Abläufen zu dokumentieren und in ihren einzelnen Phasen nachvollziehbar zu machen. Selbst bei Ereignissen, die erst vergleichsweise kurz zurückliegen, fällt diese Rekonstruktion nicht leicht. Zwar produzieren Stäbe und Truppenteile in Einsatz und Einsatzvorbereitung eine schier unendliche Flut von Daten. Die Erstellung entsprechender Übersichten sowie die Datenhaltung insgesamt krankt jedoch daran, dass bislang ein zentrales Management für die Archivierung fehlt. Unterlagen der NATO oder Vereinten Nationen sind dem nationalen Zugriff entzogen, nationale und internationale Geheimschutzbestimmungen erschweren den Zugang. Die für militärisches Schriftgut (auch elektronischer Art) vorgesehene Abgabe an das Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg erfolgt bislang noch nicht systematisch.
Für die Erforschung deutscher Auslandsmissionen sind Einsatztagebücher und zahlreiche weitere Archivbestände die wesentliche Quellenbasis. Das Bundesministerium der Verteidigung sowie Führungsstäbe der operativen Ebene haben mittlerweile der Nutzung von Dokumenten durch Mitarbeiter des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA) zugestimmt und damit eine wesentliche Voraussetzung für das neue Projekt geschaffen. Der Aktenzugang für Historiker der Bundeswehr erstreckt sich auch auf solche Unterlagen, die normalerweise der gesetzlich bestimmten 30-jährigen Schutzfrist unterliegen. Dies schließt solche Dokumente mit ein, die mit einem Schutzgrad höher als „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft sind.
Daneben muss eine Militärgeschichtsschreibung der neuesten Zeit offen sein für unterschiedlichste Formen der Überlieferung. Durch die Medien veröffentlichte Dokumente oder zeitnah publizierte Analysen aus dem sicherheitspolitischen Bereich stellen zusätzliche Informationsquellen dar. Programme zur Sicherung von Aufzeichnungen aus privaten Händen einschließlich systematischer Befragungen einsatzerfahrener Soldaten ergänzen klassische Archivalien. Derartige Interviews zählen in Deutschland und an ausländischen Instituten mittlerweile zu den wesentlichen Grundlagen für eine sachkundige, kritische und an der Realität orientierte Darstellung. Die wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit verpflichtete Militärgeschichtsschreibung muss dabei unter Beweis stellen, im Ergebnis quellenmäßig abgesicherte Analysen anstatt individueller und subjektiver Erlebnisberichte anbieten zu können.
Fragen an die neueste Militärgeschichte
Schon das Beispiel der seit 2001 laufenden Afghanistan-Mission – zunächst als Teil der US-geführten Operation „Enduring Freedom“ (OEF) und später nur noch im Verbund der ISAF – zeigt, dass Militärgeschichte weit mehr umfasst, als den Ablauf militärischer Operationen der Nachwelt zu überliefern. Militärisches Engagement im Ausland wird nur als Teil eines komplexen Umfeldes verständlich. Bei dessen Analyse muss die Militärgeschichtsschreibung zunächst vorgehen wie die Krisen- und Konfliktberatung. Diese betrachtet Krisengebiete möglichst ganzheitlich („Comprehensive Approach“), um Hinweise für eine erfolgreiche, militärisch-zivile Konfliktlösung und Stabilisierung geben zu können. Im Rahmen militärgeschichtlicher Analysen der ISAF-Mission gilt es dementsprechend, im Verbund Ergebnisse und Misserfolge der Intervention sowie die seit 2001 immer wieder substanziell veränderten Einsatzstrukturen und -verfahren zu untersuchen, und ebenso den Wandel dahinter stehender Stabilisierungskonzepte („Wiederaufbau“, Demokratisierung, Counter-Insurgency, COIN, etc.).
Der laufende Einsatz beeinflusste maßgeblich die Bundeswehr als Gesamtorganisation. Diese musste sich als lernende Institution bewähren und Ausbildung und Einsatzvorbereitung schrittweise den veränderten Rahmenbedingungen in Afghanistan anpassen. Als wesentlicher Aspekt des nationalen Umfeldes erwies sich die Wahrnehmung der ISAF bzw. des Bundeswehr-Beitrags in der deutschen Mediendemokratie, nicht zuletzt auch für die Fortschreibung des politischen Mandates. Die internationale Militärgeschichtsschreibung als Wissenschaftsdisziplin begann sich verstärkt mit der Entwicklungsforschung oder den Politikwissenschaften auszutauschen. Beispielsweise durch historische Analysen afghanischer Staatlichkeit und Gesellschaft oder der sowjetischen Besatzung zwischen 1979 und 1989 brachte sie sich in den USA und in Europa mehr oder weniger erfolgreich in die Diskussion über den zukünftigen Weg für Afghanistan ein.
Jenseits komplexer Einzelfallstudien bilden die außen- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen für militärische Einsätze ein zweites Untersuchungsfeld, verbunden mit der Frage nach der Rolle der Streitkräfte im politischen System der Bundesrepublik Deutschland nach 1990. Wie entwickelten sich die Sicherheitsstrukturen von NATO und EU, was kennzeichnete deutsche Außen- und Sicherheitspolitik seit der Wiedervereinigung, und wie gestaltete sich die europäische und transatlantische Wahrnehmung der Mittelmacht Deutschland? Im nationalen Rahmen gilt es aufzuzeigen, welche Meilensteine den parlamentarischen Umgang mit militärischer Friedenssicherung und -erzwingung bestimmten, oder auch wie politisch die Bundeswehr als Organisation dachte.
Hier schließt drittens die Frage nach der Führungskultur und Selbstwahrnehmung einer Armee im Wandel an. Wie hielten Spitzengliederung und Streitkräftestrukturen, Bewaffnung und Ausrüstung sowie die Entwicklung und Beschaffung neuer Rüstungsgüter mit den neuen Aufträgen Schritt? Bewährte sich die „Innere Führung“ auf dem Prüfstand der Auslandseinsätze? Wie veränderte sich das Selbstbild von Soldaten seit der Wiedervereinigung angesichts neuer Aufträge? In welcher Weise wirkten die Auslandsmissionen und mehr als 50 Jahre Bundeswehr-Geschichte identitätsbildend?
Ein vierter Aspekt zeigt die Bundeswehr als Teil der Gesamtgesellschaft. Das Verhältnis zwischen den Streitkräften und der Öffentlichkeit war generell gekennzeichnet von „freundlichem Desinteresse“. Soldaten machten die individuelle Erfahrung, mit ihrem von der Politik erteilten Auftrag oftmals alleine gelassen zu werden. Sie beklagten mangelnde Konsequenz beim Umgang von Öffentlichkeit und Politik mit unbequemen Folgeerscheinungen wie gefallenen oder verwundeten Soldaten, getöteten Zivilisten oder drängenden Aufforderungen im Bündnis, Deutschland müsse mehr militärische Verantwortung übernehmen. Andere Konfliktfelder traten hinzu. Welche Rolle spielte etwa im historischen Rückblick die Wehrpflicht mit Blick auf militärisches Engagement im Ausland? Und obwohl 2011 etwa jeder zehnte Soldat im Einsatz der Reserve angehörte, konnten neue Reservistenkonzeptionen bislang der wachsenden Bedeutung dieser Personengruppe für Ausbildung und Einsatz nicht ausreichend Rechnung tragen. Wechselseitige Verbindungen und Wahrnehmungen zwischen der Bundeswehr und den Gesellschaften in den Einsatzländern schließlich stellen ein weiteres, höchst relevantes Untersuchungsfeld dar, das allein mit den Mitteln klassischer Militärgeschichte nicht bearbeitet werden kann.
Schließlich muss sich die Militärgeschichte der neuesten Zeit fünftens mit dem einzelnen Menschen, mit Einsatz- oder Kriegserlebnissen sowie mit dem individuellen Verhalten von Soldaten befassen. „Die Bundeswehr“ zerfällt diesbezüglich bei näherem Hinsehen in zahlreiche, nebeneinander existierende Binnenkulturen der Teilstreitkräfte, Organisationsbereiche oder Truppengattungen. Das Erfahrungsspektrum reicht vom Infanteristen im täglichen Patrouillendienst bei Kundus bis hin zum Stabsoffizier, der als Militärbeobachter im Sudan unter dem Kommando der Vereinten Nationen steht. Einsatzkontingente, die ihren Auftrag für begrenzte Zeit erfüllen und danach wieder zerfallen, entwickeln ein strukturelles und soziales Eigenleben. Sie „funktionieren“ in Einsätzen unterschiedlicher Intensität bei näherem Hinsehen auf differenzierte Weise und bilden komplexe Binnenstrukturen aus. In historischer Perspektive gilt es zu zeigen, wie sich einsatzerfahrene Soldaten selbst definieren und gegenüber anderen abgrenzen, wie sie Ausbildung und Einsatz wahrnehmen, strukturieren und bewältigen. Erfahrungen mit der Verarbeitung von Kriegserlebnissen aus der deutschen Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts können diesbezüglich wichtige methodische Anhaltspunkte liefern, doch sind die Erkenntnisse der Weltkriegsforschung insgesamt nur mit großer Vorsicht auf die neueste Zeit zu übertragen.
Forschung und Bildung für Bundeswehr und Öffentlichkeit
Seit dem Sommer 2010 beleuchtet das Projekt „Einsatzarmee Bundeswehr“ am MGFA mit überwiegend historischen Methoden die umrissene Anpassung der Bundeswehr an neue Aufgaben („Transformation“), den Prozess von Wandel und Modernisierung und sein gesellschaftlich-politisches Umfeld. Diese zeitgeschichtliche Betrachtung von Streitkräfteentwicklung und Auslandseinsätzen wirft die Frage nach den zukünftigen Aufgaben der Militärgeschichtsschreibung selbst auf. Innerhalb der Institution Bundeswehr, so viel scheint sicher, soll sie verstärkt Orientierungswissen für Soldaten bereitstellen und so Grundlagen für deren Selbstverständnis im Sinne militärischer Identität schaffen. Eine solche Aufgabenzuweisung birgt erheblichen Zündstoff. Einerseits befürchten Kritiker insgesamt eine zunehmende Anwendungsorientierung der Militärgeschichte als Wissenschaftsdisziplin. Diese laufe angesichts einer neuen Ausrichtung der Bundeswehr Gefahr, auf den Stand rein operativ ausgerichteter Generalstabsgeschichte und der bloßen Vermittlung kriegsgeschichtlicher Beispiele im Sinne von „Lessons Learned“ (Applikatorik) zurückzufallen. Befürworter hingegen fordern einen konkreten Nutzen militärhistorischer Forschung über einen allgemeinen Erkenntnisfortschritt hinaus. Sie sehen die laufende Diskussion als Teil einer größeren, legitimen Debatte darüber, was die Geisteswissenschaften insgesamt zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft beitragen müssen und können.
Die neueste Militärgeschichte hat sich in den letzten Jahren in diesem Spannungsfeld eingerichtet und führt die notwendigen inhaltlichen Auseinandersetzungen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Streitkräften und Öffentlichkeit. Die im Grundgesetz garantierte Freiheit der Forschung steht dabei auch mit Blick auf kritische Befunde nicht zur Diskussion. Dass der Wandel militärischer Einsätze die Nachfrage nach stärkerer Anwendungsorientierung mit sich bringt, bedeutet unter Gesichtspunkten der Relevanz sogar eine große Chance. In der neuen Bundeswehr- Struktur wird das MGFA, beginnend ab Januar 2013 und unter neuem Namen, durch die Fusion mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut militärhistorische und soziologische Fähigkeiten der Bundeswehr unter einem Dach am Standort Potsdam vereinen. Die Militärgeschichte wird dadurch, unter Beibehaltung von Forschungsschwerpunkten zum Zeitalter der Weltkriege, zur Bundeswehr vor 1990 und NVA in ihren Bündnissen sowie von wesentlichen Aufgaben im Bereich der historischen Bildung, näher an die Gegenwart heranrücken. Strukturell kommt dies in der Einrichtung einer neuen Abteilung „Einsatz“ zum Ausdruck.
Datum: 30.09.2012
Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2012/3