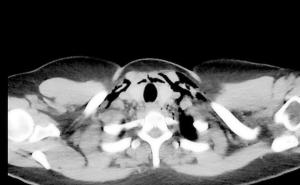ZUM 200. JAHRESTAG DER VÖLKERSCHLACHT BEI LEIPZIG: ZWISCHEN HÖRSAAL UND SCHLACHTFELD – ZEUGNISSE ÄRZTLICHEN HANDELNS*
Battle of Nations at Leipzig in 1813:Between Lecture Hall and battlefield – Evidences of medical activity
Franz-J. Lemmens
Zusammenfassung
Der äußerst verlustreiche Russlandfeldzug Napoleons führte zur Einschleppung vieler Infektionskrankheiten auch nach Sachsen. Die dort vorhandene Lazarettkapazität war schnell erschöpft. Die Frühjahrs- und Herbstfeldzüge des Jahres 1813 verschärften die Lage noch mehr. Zunehmend wurde auch die Zivilbevölkerung vom erneut aufgetretenen Typhusgeschehen betroffen. Eine dramatische Lage ergab sich dann auf dem Höhepunkt der Schlacht und für die nachfolgende Zeit. Leipzig hatte damals 33 000 Einwohner und konnte die nahezu doppelte Anzahl an Verwundeten, Kranken und Gefangenen nicht mehr versorgen.
Leipziger Ärzte, darunter einige Ordinarien der medizinischen Fakultät der Universität, schilderten unhaltbare Lazarettsituationen und Versuche, der Seuchen Herr zu werden.
Die Schicksale prominenter Universitätsmediziner wie Johann Christian Clarus oder Karl Gustav Carus werden ebenso dargestellt wie die Gründe für ihr selbstloses Handeln in diesen kritischen Tagen.
Schlagworte: Völkerschlacht, 1813, Leipzig, Verluste, medizinische Versorgung, Ärzte.
Summary
Napoleon’s Russian campaign involving heavy losses led to the introduction of many infectious diseases to Saxony, too. The capacities of existing hospitals were quickly exhausted. The spring and autumn campaigns of 1813 made the situation even more worst. Increasingly, the civilian population had been affected by typhoid epidemics again. A dramatic situation arose at the height of the battle, and thereafter. Leipzig had 33,000 inhabitants at the time and was no longer able to provide medical support an almost doubling of the number of wounded, sick and prisoners. Leipzig doctors, including professors of the medical faculty of the university, described untenable situations in hospitals and attempts to become master of diseases. Individual fate of some prominent university physicians such as Johann Christian Clarus and Carl Gustav Carus is shown, as the reasons for their selfless actions in those critical days.
Keywords: battle of nations, 1813, Leipzig, casualties, medical support, physicians.
Einführung
Das Ende der napoleonischen Vorherrschaft in Europa begann bekanntlich mit der Zerschlagung der „Grand Armee´“ im Russlandfeldzug von 1812, setzte sich fort mit der Völkerschlacht im Jahre 1813 und fand schließlich 1815 im Sieg der Alliierten bei Waterloo – treffend auch Belle Alliance genannt – seinen Abschluss.
Der Weg dahin war von unbeschreibbaren Leiden ebenso gezeichnet wie von Mut, Tapferkeit und Patriotismus, den beide Seiten, wenngleich auch aus unterschiedlicher Motivation, aufzubringen hatten. Das wird in besonderer Weise deutlich, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Völkerschlacht um die bis dahin größte Schlacht gehandelt hat. Zwischen 500 000 bis 600 000 Soldaten aus vielen europäischen Ländern standen sich hier auf einem sehr begrenzten Territorium gegenüber.
Um die militärische Entwicklung des Jahres 1813 speziell in Sachsen zu verstehen zu können, muss sich der Blick zunächst auf den Russlandfeldzug Napoleons von 1812 richten.
Er begann ihn, einschließlich der Hilfstruppen, mit 420 000 Mann, die er bald darauf um weitere 150 000 ergänzte (1, S. 399). Andere Quellen berichten gar von einer Gesamtstärke von 594 000 Mann (2, S. 185, 217–281). Seine eigentliche berühmte „Grand Armee´“ bestand hingegen aus 350 000 Soldaten.
Die militärische Bilanz dieses Abenteuers sah verheerend aus. Denn nur noch etwa 30 000 versprengten Soldaten war es im Dezember 1812 gelungen, mit größter Mühe und von den Truppen des russischen Oberbefehlshabers Michail I. Kutusov (1745 – 1813) bedrängt, den Njemen zu überschreiten.
Die Schlachten bis dahin verbinden sich mit Namen wie „bei Moskau, Borodino, Smolensk oder an der Beresina“. Sie alle waren für beide Seiten äußerst verlustreich. Die sehr langen Versorgungswege und deren Kräfte bindende Sicherung, eine völlig unzureichende Ausrüstung und Vorbereitung der Armee angesichts des russischen Klimas, der damit in Zusammenhang stehende Hunger und die zunehmende Entkräftung dezimierten diese große Armee expressis verbis ebenso wie die noch zu besprechende epidemiologische Lage.
Letztere war aufgrund der zunehmenden Zahl von Erkrankten mit Infektionskrankheiten wie Typhus, Fleckfieber und Ruhr, oder dem in Osteuropa epidemischen Wolhynischen Fieber – auch Fünftagefieber genannt – bedrohlich
Der Durchzug besonders durch Sachsen, machte dort die Einrichtung von „101 Lazaretten, die bald mit Typhuskranken angefüllt waren“ (3, S. 40–44), notwendig. Auch die Zivilbevölkerung hatte, wie in Leipzig, bis weit in das Jahr 1814 unter dem Typhus zu leiden. Vollstädt führt hier allein für das Jahr 1813 13 500 zivile Typhusfälle an, von denen 2 700 starben. Mithin betrug die Letalität etwa 20 % (4, S. 189–191).
Auf die nähere Beschäftigung mit der Geschichte dieser Krankheitsbilder und ihrer damaligen wie auch heutigen Behandlung muss an dieser Stelle aus verständlichen Gründen verzichtet werden. Nachdem es Napoleon gelungen war, durch die Aushebung junger und jüngster Jahrgänge neue Kräfte zu formieren, glaubte er den Krieg fortsetzen zu können.
Seinem Verlauf nach ist er zeitlich in einen Frühjahrs- und einen Herbstfeldzug zu unterscheiden. Die Verluste waren für beide Seiten, zumal für Napoleon hoch. So verlor er beispielsweise während des Frühjahrsfeldzuges in Großgörschen (bei Lützen) am 02.05. und in Bautzen am 20./21.05.1813 schon mehr als 40 000 Mann. Ebenso verlustreich verliefen für ihn die bedeutenderen Gefechte während des Herbstes am 26.08. an der Katzbach und in Dresden am 26./27.08. (dem letzten Sieg Napoleons auf deutschem Boden) sowie am 06.09.1813 in Bennewitz mit über 35 000 Toten und Verwundeten.
Die deshalb rasch erschöpften französischen Lazarettkapazitäten Sachsens, und damit auch Leipzigs sollten durch Erweiterungen und Schaffung von Provisorien kompensiert werden.
War die französische Administration anfangs noch daran interessiert, die Leitung der Lazarette zu behalten, konnten sich die Leipziger Ärzte mit ihrer Forderung durchsetzen, diese Lazarette in Zuständigkeit der Stadt zu belassen, was sich letztlich als die bessere Lösung heraus stellen sollte.
Da in den Gefechten jener Zeit der Einsatz von Artillerie dominierte, nahmen die dadurch entstandenen Verwundungen den ersten Platz ein, gefolgt durch die von Infanteriegeschossen und scharfen Waffen verursachten Verletzungen. Bei den Planungen ging man üblicherweise von einem Verwundetenaufkommen von 10 % aus. Die Realität wurde mit circa 30 % jedoch weit übertroffen und liefert eine weitere Erklärung für die desolate Lazarettsituation.
Als dann die Schlacht bei Leipzig geschlagen war, wird von bis zu 56 Lazaretten gesprochen, die zumeist diesen Namen nicht verdienten. Am 23.10.1813 gab es immer noch 39 solcher Einrichtungen in einer Stadt, die damals nur 33 000 Einwohner zählte und in denen 20 944 (!) Verwundete und Kranke lagen.
Zu deren ärztlichen Versorgung sind uns 33 Ärzte namentlich bekannt, von denen viele Angehörige der Universität oder Wundärzte der Stadt waren. Ferner werden ohne Namensnennung 78 Chirurgen und eine unbekannte Anzahl sächsischer und französischer Chirurgen und Wundärzte angeführt. Über deren fachliche Qualifikation ist uns indessen nur wenig bekannt (5, Anl. 15).
Medizinische Lage während und nach der Schlacht bei Leipzig
Am Abend des 18.10. sah sich Napoleon durch die hohen Verluste und den Munitionsmangel zum Rückzug gezwungen. Wie schon in den Tagen zuvor erfolgte ohne Rücksicht auf die Transportfähigkeit der Verletzten, deren Verlegung in Richtung Mainz und viele der Lazarette wurden dem Feuer übergeben. Viele der auf dem Schlachtfeld Erstversorgten sollten in Leipzig weiter behandelt werden, wovon Johann Jakob Röhring als Zeitzeuge berichtet.
„ … Ein großes Zimmer lag gepfropft voll, fast lauter Kürassiere, denen die Arme oder Beine teils weggeschossen, teils abgeschlagen waren. Ich sah lange zu. ….. Über der Stelle, wo das Bein oder der Arm abgenommen werden sollte, wurde es mit einem Tuche fest zugebunden, natürlich um den zu starken Zudrang des Blutes zu hindern. Nun wurde ein Schnitt rundum bis auf den Knochen geführt, sofort das Fleisch zurückgedrängt und der Knochen durchsägt. Dann wurden mit einer Zange die Adern hervorgezogen und unterbunden, auch etliche mit einem Eisen zugebrannt, das Fleisch wurde wieder hervorgezogen und Charpie – gezupfte Leinwand, mit Kalk- oder Bleiwasser getränkt – darauf gelegt. Dies alles war eine Arbeit von etlichen Minuten, und die Operation war geschehen.“ (5, S. 113).
Die erwähnte Charpie bestand keineswegs nur aus besagter Leinwand, man benutzte auch Hemden, ja sogar Baumrinden und Pflanzenfasern, was Wundinfektionen zur Folge hatte. Grundmann schreibt dazu: „Es war eine Zeit ohne Antisepsis und Anästhesie, an Medikamenten standen dem Chirurg nur Opium, Baumrinde und Quecksilber zur Verfügung.“ (6, S. 187 – 192). Um die unfassbaren Zustände noch deutlicher werden zu lassen, darf der oft zitierte Bericht von Prof. Johann Christian Reil (1759–1813), der allein schon eine eigene Würdigung aus Anlass seines 200. Todestages verdient haben würde, nicht fehlen. Er hatte ihn an den Leiter der Zentralverwaltungsbehörde, Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757 – 1831) gerichtet, der ihm Anfang Oktober 1813 die Leitung der Militärlazarette in Halle und Leipzig übertragen hatte.
In J. Chr. Reil begegnen wir dem ersten 1811 gewählten Dekan der Berliner Medizinischen Fakultät, der bereits 1808 den Begriff „Psychiatrie“ prägte und wegen seiner Arbeiten und Reformvorschläge auf diesem Gebiet gerne mit dem sich für das Los psychisch Kranker so verdienstvoll einsetzenden französischen Psychiater Philippe Pinel (1745 – 1826) verglichen wurde (7, S. 405f). In dem erschütternden Bericht Reil´s vom 26.10.1813 nach seiner Visitation der Lazarette in Halle und Leipzig liest man zur Situation in Leipzig: „In Leipzig fand ich ungefähr 20 000 Verwundete und Kranke von allen Nationen. Die zügelloseste Phantasie ist nicht im Stande, sich ein Bild des Jammers in so grellen Farben auszumalen, als ich es in der Wirklichkeit vor mir fand. ….. Man hat unsere Verwundeten an Orten niedergelegt, die ich der Kaufmännin nicht für ihr krankes Muppel anbieten möchte. Sie liegen entweder in dunklen Spelunken, in welchen selbst das Amphibienleben nicht Sauerstoffgas genug finden würde, oder in scheibenleeren Schulen und wölbischen Kirchen, wo die Kälte der Atmosphäre in dem Maasse wächst, als ihre Verderbnis abnimmt, bis endlich einige Franzosen ganz ins Freie hinausgeschoben sind, wo der Himmel das Dach macht und Heulen und Zähneklappern herrscht. An dem einen Pol tödtet die Stickluft, an dem anderen reibt der Frost die Kranken auf. Bei dem Mangel öffentlicher Gebäude hat man dennoch nicht ein einziges Bürgerhaus dem gemeinen Soldaten eingeräumt. An jedem Orte liegen sie geschichtet wie Häringe in ihrer Tonne, alle noch in den blutigen Gewändern, in welchen sie aus der heissen Schlacht herbeigetragen sind. Unter 20 000 Kranken hat auch nicht ein einziger ein Hemd, Bettuch, Decke, Strohsack oder Bettstelle erhalten. Sie haben nicht einmal Lagerstroh, sondern die Stuben sind mit Häckerling aus den Bivouaks ausgestreut, der nur für den Schein gelten kann. Alle Kranken mit zerbrochenen Armen und Beinen, denen man auf der nackten Erde hat keine Lage hat geben können, sind für die verbündete Armee verloren. Ein Theil derselben ist schon todt, der andere wird noch sterben. Ihre Glieder sind wie nach Vergiftungen furchtbar aufgelaufen, brandig und liegen nach allen Richtungen neben den Rümpfen, daher der Kinnbackenkrampf in allen Ecken und Winkeln, welcher um so mehr wuchert, als Hunger und Kälte seiner Hauptursache zu Hilfe kommen. …Viele Blessirte sind noch gar nicht verbunden. Die Binden sind zum Theil von grauer Leinwand aus Dürrenberger Salzsäcken geschnitten, die die Haut mitnehmen, wo sie noch ganz ist. In einer Stube stand ein Korb mit rohen Dachschindeln zum Schienen der zerbrochenen Glieder. Viele Amputationen sind versäumt, andere werden von unberufenen Menschen gemacht, die kaum das Barbiermesser führen können und die Gelegenheit benutzen, ihre ersten Ausflüge an den zerschmetterten Gliedern unserer Krieger zu versuchen.
Die braunrote Farbe der durchgesägten Muskeln, des Operirten nachmalige Lage und Pflege geben nur wenig Hoffnung zu seiner Erhaltung, doch hat er den Vortheil davon, dass er auf einem kürzeren Wege zu seinem Ziele kommt. An Wärtern fehlt es ganz. Verwundete, die nicht aufstehen können, müssen Koth und Urin unter sich gehen lassen und faulen in ihrem eigenen Unrathe an. Für die Gangbaren sind zwar offene Bütten ausgesetzt, die aber nach allen Seiten überströmen, weil sie nicht ausgetragen werden. In der Petrikirche stand neben einer solchen Bütte eine andere ihr gleiche, die eben mit der Mittagssuppe hereingebracht war. Diese Nachbarschaft der Speisen und Ausleerungen und die Möglichkeit, dass eine triefäugige Ausgeberin die Kelle einmal in die unrechte Bütte tauchen kann, muss nothwendig einen Ekel erregen, welchen nur der grimmigste Hunger zu überwinden im Stande ist. In der Petrikirche sah ich der Vertheilung des Mittagbrotes zu. Die Fleischportion wog 2 – 4, das Brod für den Tag ungefähr 8 – 12 Loth. Die Suppe bestand aus Wasser, in welchem die Reiskörner gefischt werden mussten. Bier und Branntwein wurde hier gar nicht gegeben. An anderen Orten hatte er nur den Geruch des Fusels, enthielt kaum zehn Prozent Alkohol, der nicht einmal durch die Epidermis eines Kosakenmagens dringen kann.
Bei dieser Diät, die kaum einen Südländer auf den Beinen halten kann, gehen unsere nordischen Völker in kurzer Zeit verloren, verfallen in Nervenschwäche und schwinden wie der Schatten dahin. ..... Ich schliesse meinen Bericht mit dem grässlichsten Schauspiele, das mir kalt durch die Glieder fuhr und meine ganze Fassung lähmte. Nämlich auf dem offenen Hofe der Bürgerschule fand ich einen Berg, der aus Kehricht und Leichen meiner Landsleute bestand, die nackt lagen und von den Hunden und Raben angefressen wurden, als wenn sie Missethäter und Mordbrenner gewesen wären. So entheiligt man die Ueberreste der Helden, die dem Vaterlande gefallen sind! Ob Schlaffheit, Indolenz oder böser Wille die Ursache des schauderhaften Looses ist, das meine Landsleute hier trifft, die für ihren König, das Vaterland und die Ehre der deutschen Nation geblutet haben, mag ich nicht beurtheilen.
Ich appellire an Euer Excellenz Humanität, an Ihre Liebe zu meinem König und seinem Volke, helfen Sie unseren Braven, helfen Sie bald; an jeder versäumten Minute klebt eine Blutschuld. Legen Sie ein Schock kranker Baschkieren in die Betten der Bankiersfrauen – und geben Sie in jedes Krankenzimmer einen Kosaken mit, der für Aufrechterhaltung der Ordnung verantwortlich ist. Diese Massregel, die gewiss Lust und Liebe zum Dinge macht, scheint mehr hart zu sein, als sie es wirklich ist. Der Kranke muss ins Bett und die Gesunden zu seiner Wartung vor denselben kommen. Wir bespötteln sonst in dem Tadel des Hottentotten, der sich ins Bett legt, wenn die Frau geboren hat, nur unsere eigene Inkonsequenz. J. C. Reil“ (5, Anl. 14).
Dieser detaillierte Bericht von Reil mag – pars pro toto – wohl für die meisten derartiger Lazarette zutreffend gewesen sein. Die beschriebenen wahrhaft erschreckenden Zustände waren die logische Konsequenz eines angesichts dieses Massenanfalls an Verwundeten und Kranken hoffnungslos überforderten Sanitätswesens. Aber auch die städtische Verwaltung konnte nicht die nötigen Unterkünfte bereitstellen. Großbauten im heutigen Sinne bestanden nicht, wohl aber viele Provisorien, bestenfalls feldlazarettähnliche Einrichtungen (Abb. 1).
Hinzu kam, dass durch die vorzeitige Sprengung der Elsterbrücke viele Franzosen in Gefangenschaft gerieten und auch nach einer Bleibe suchten. So befanden sich noch am 07.12.1813 viele von ihnen in Leipzig, darunter 15 Generale, 205 Stabsoffiziere, 1 217 Offiziere, 20 551 Sergeanten und Soldaten sowie 3 907 Pferde (8, Bl. 64). Einer Aufstellung der Stadt zufolge befanden sich darunter 57 französische Ärzte und Lazarettbeamte (8, Bl. 81–111), die, soweit sie nicht fliehen konnten, nun mit ihren Patienten das Los der Gefangenschaft zu teilen hatten.
Einige von ihnen konnten anhand der im Internet publizierten „Annaire officiel de lármee francaise“ identifiziert werden. Letztlich konnte Reil also bei diesen Verhältnissen mit seinen den Zustand der Lazarette betreffenden Interventionen nur wenig erreichen (9, Bl. 82). Es ist wohl möglich, dass sich Reil durch die vielen, besonders auch ärztlichen Kontakte ebenfalls an Typhus infiziert hatte. Fiebernd schaffte er noch die Rückreise an seinen Wohnort Halle, wo er aber am 22.11.1813 an dieser Infektion verstarb.
Was hätte dieser hoch geschätzte und auch von Goethe verehrte Wissenschaftler noch bewegen können?
Das gleiche Schicksal ereilte den im Februar 1812 zum Professor berufenen Johann Carl Gehler (1783 – 1813), der als erster Chirurg in Deutschland die Oesophagotomie durchführte, und der neben Johann Gottlieb Eckoldt (1746 – 1809) zu den ersten chirurgischen Demonstratoren am Jakobs-Hospital gehörte.
In dieser Einrichtung der Universität lagen viele französische Typhuskranke.
Da „die französischen Ärzte direkt gezwungen werden mussten, die Behandlung ihrer Landsleute zu übernehmen“ waren sie mehr Belastung als Entlastung. Man liest dazu bei Lutze weiter: „Zu diesen Opfern zählte auch Johann Carl Gehler, der das tückischste Lazarettfieber nicht scheuend, mit anderen Berufsgenossen sich der von den französischen Ärzten verlassenen kranken und der verwundeten Soldaten angenommen hatte, die in großen Mengen in den Leipziger Hospitälern (und zwei weiteren Einrichtungen der Universität – F. L.) untergebracht waren. Das Lazarettfieber raffte ihn hin, wie so manchen seiner Genossen, dem Pflichttreue über Todesfurcht ging.“ (10, S. 43).
Das führt zu der Frage, welche Beweggründe Ärzte wie Reil für ihr selbstloses Handeln gehabt haben mögen. Immerhin kannten sie alle ihre persönlichen Risiken sehr genau. Möglicherweise kann man auch ihnen jenen Patriotismus zusprechen, der inzwischen weite Teile des Volkes erfasst hatte. Ganz sicher aber dürfte ihr Handeln von den Prinzipien des ärztlichen Ethos bestimmt gewesen sein.
Leipziger Ärzte in der Verwundetenbetreuung (Auswahl)
Freilich können hier nicht alle der damals Hilfe leistenden Ordinarien der Leipziger Fakultät vorgestellt werden, von denen immerhin einige für die Geschichte der Medizin bedeutsam wurden. So sei etwa an Johann Christian Heinroth (1773 – 1843) erinnert, der 1811 den Lehrstuhl für psychische Therapie und damit das erste Ordinariat für Psychiatrie in Deutschland erhalten hatte (11, S. 24). Mit anderen Kollegen betreute er das von französischen Verwundeten belegte und bereits erwähnte Lazarett place de repos (5, Anl. 15). Auch sei auf Friedrich Philipp Ritterich (1782 – 1866) verwiesen, dem es gelang, aus Spendenmitteln eine Heilanstalt für Augenkranke zu begründen und der 1826 zum außerordentlicheno Professor für „Ophthalmiatrik“ berufen wurde (11, S. 24).
Ritterich leitete das vorwiegend von Russen belegte Lazarett „Kurprinz“ (5, Anl. 15).
Man könnte weitere Persönlichkeiten aus dem universitären Bereich anführen, wie etwa den bereits genannten Gynäkologen Johann Christian Jörg (1779 – 1856) oder die hier stellvertretend für ihre Kollegen vorzustellenden Johann Christian Clarus (1774 – 1854) und Carl Gustav Carus (1789 – 1869). Das Leben von Johann Christian Clarus war in besonderer Weise eng mit der Universität und der Stadt Leipzig verbunden. Sehr früh wurde er zum Dr. phil. und Dr. med. promoviert, im Jahre 1804 zum Extraordinarius für Anatomie und Chirurgie und damit zugleich auch zum Prosektor berufen. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit wurde ihm 1811 das Amt des Stadtphysikus übertragen, was nach heutigem Verständnis mit der Leitung eines Gesundheitsamtes verglichen werden kann. Diese städtische Funktion schloss auch die Aufsicht über die schon lange vor der Schlacht in Leipzig bestehenden Lazarette ein, eine Aufgabe, die sich für ihn unmittelbar nach der Schlacht extrem auszuweiten begann. Einige der aus dieser Amtszeit überkommenen Ratsakten, darunter jene aus der Ratsstube, dem Verwaltungskern des Leipziger Rates, enthalten Informationen zu den bereits im Frühjahr getroffenen hygienisch-antiepidemischen Maßnahmen, soweit man davon angesichts des damals bestehenden Wissensstandes überhaupt sprechen kann. Zu den am 27.02.und 06.03.1813 an die Bürgerschaft gerichteten Empfehlungen zur Vermeidung von Infektionen, seien „mineralsaure Räucherungen“ für die Luftreinigung im häuslichen Bereich besonders geeignet. Hierzu sollten 10 Teilen NaCl und 2 Teilen Braunstein langsam 8 Teile reines Vitriol beigefügt werden, das von allen Apotheken bezogen werden könne.
Diese und auch andere „Räucherungen“, wozu auch das unter dem russischen Stadtkommandanten Oberst Victor von Prendel (1766 – 1852) veranlasste Abbrennen von Pferdedunghaufen, den „Prendelkerzen“, gehörte, waren der seinerzeitigen miasmischen Vorstellung geschuldet. Hinweise wie etwa der Verzicht auf Krankenbesuche, absolute Reinlichkeit und eine ständige, auch polizeilich gesicherte Kontrolle der Ein- und Ausreise waren jedoch weitaus zweckmäßiger. Angesichts des zunehmenden Mangels an Nahrungsmitteln war die Aufforderung zur Mäßigung in gewisser Weise verständlich, den Ärmeren (!) jedoch fleischlose Kost anzuraten, hingegen mehr als beschämend.
Clarus verweist auf die ungünstige Situation des Lazarettes „place de repos“ und darauf, dass man Lazarette und ähnliche Einrichtungen vor die Stadt verlegen solle. Ebenfalls seien die erkrankten Offiziere aus ihren Bürgerquartieren zu entfernen, an deren Verbleib allein die Vermieter finanziell interessiert seien. Ferner verlangte er die Einrichtung eines „Krankenbüros“ vor den Stadttoren, am besten bei der Wohnung des Torschreibers. Dort habe sich ständig ein Stadt-Deputierter, ein Arzt und ein Schreiber sowie mehrere Gendarmen oder Polizeidiener aufzuhalten, welche die vom Arzt erkannten Kranken sofort in ein Militärspital zu bringen hätten. Auch richtete er am Fleischerplatz eine ärztliche Kontrollstelle ein, für die er die späteren mehrmaligen Dekane, die Professoren Dr. Wendler und Dr. Kuhl mit festen Sprechzeiten benannte (12, Bl. 24–29, 38a und b;78ff). Auch Professor Karl Gottlob Kühn (1754 – 1840) (Abb. 2), der erste Ordinarius des 1812 geschaffenen Lehrstuhls für Chirurgie, zählte zu den prominenten akademischen Helfern.
Die zunehmende Erfassung und Isolierung der Infektionskranken, ihre Unterbringung in besonderen Lazaretten, trug wesentlich zu dem allerdings nur langsamen Rückgang des Krankheitsgeschehens im Jahre 1814 bei (13, S. 428 ff.).
Für seine persönliche Betreuung der russischen Verwundeten erhielt Clarus später das Ritterkreuz des Wladimir-Ordens 4. Klasse, 1818 den Sächsischen Verdienstorden und den damit verbundenen Titel „Königlich-sächsischer Hofrat“ und wurde 1837 schließlich Ehrenbürger von Leipzig. Doch ist der Name Clarus im Zusammenhang mit seinen Gutachten über den am 27.08. 1824 wegen Mordes an seiner Geliebten hingerichteten Johann Christian Woyzeck (1750 – 1824) wohl bekannter geworden.
Georg Büchner (1813 –1837) hatte durch seinen Vater, der ärztlicher Mitarbeiter der „Zeitschrift für Staatsarzneikunde“ war, Zugang zu den dort publizierten Gutachten und schrieb dazu sein bekanntes Drama. Eine tödlich verlaufene Typhuserkrankung hinderte ihn an der Vollendung seines Werkes, welches dann vor 100 Jahren im Münchner Residenztheater seine Uraufführung erlebte. In seinem, von Kollegen kritisierten 2. Gutachten von 1824, in welchem er sich zwar durch seinen Kollegen Heinroth bestätigt sah, kam Clarus zu der aus heutiger Sicht irrigen und für Woyzeck folgenreichen Annahme, dass dieser voll zurechnungsfähig sei. Dessen offenkundig paranoider Zustand hätte nach der derzeitigen ICD 10 wohl mit F 22, also einer wahnhaften Störung, beurteilt werden müssen.
Carl Gustav Carus (Abb. 3), einer der vielseitigsten Gelehrten des 19. Jahrhunderts, studierte in Leipzig neben Medizin auch Physik, Chemie und Botanik. Bereits im Alter von 22 Jahren besaß er den Dr. med. et phil. und war Assistent seines ihn fördernden Doktorvaters Prof. Jörg, dem Direktor des „Trier´schen Instituts“, der Hebammenschule der Universität.
Dieser berufliche Beginn war für Carus wegweisend, was seine Berufung zum Leiter der Königlichen Hebammenschule in Dresden im Jahre 1814 belegt. Bereits ein Jahr später wurde er dort ordentlicher Professor und zählt damit zum Mitbegründer der „Chirurgischen Medizinischen Akademie“, deren Nachfolgeeinrichtung heute seinen Namen trägt.
Zu der großen Vielseitigkeit von Carus gehört fraglos auch sein später so bedeutendes malerisches Schaffen. Seine Studien dazu setzte er an der 1764 gegründeten Leipziger Zeichenakademie unter dessen Rektor Johann Friedrich Tischbein (1750 –1812), dem „Leipziger Tischbein“, erfolgreich fort. Der Romantiker Carus unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit wie dem Maler Caspar David Friedrich (1774 – 1840), den Dichtern Johann Wolfgang von Goethe (1750 – 1832) und Ludwig Tieck (1773 – 1853) ebenso wie zu Alexander von Humboldt (1769 – 1859) und dem sächsischen König Johann I. (1801/1854 – 1873), dessen Leibarzt er wurde und dessen Familie er hernach betreute (14). Ausdruck seines hohen Ansehens in der Wissenschaft und der Gesellschaft seiner Zeit, war eine ihm zu Ehren im Jahre 1847 geprägte Medaille (Abb. 4). Seinen Erinnerungen nach fand er sich im Frühjahr 1813 zur Einrichtung und Direktion eines französischen Militärhospitals beim damaligen Pfaffendorf bereit, wo er täglich bei den etwa 200 Patienten und in einem benachbarten Lazarett seine Visiten abhielt. Einige seiner Unterärzte waren bereits an Typhus erkrankt. So schrieb er von einer „ … Zeit, die wie sie so vielen Ärzten und Wundärzten Tod brachte, auch mich beinahe mit hinweg genommen hätte, … mich der Typhus ergriff und lange am Grabesrande hielt.“ (15, S. 90). Als er die Direktion übernahm, habe ihn seine „Familie beschworen, Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen, um eigene Erkrankung in der Spitalluft zu verhüten.“ (15, S. 91).
Wie sahen seine diesbezüglichen Maßnahmen aus?
„Ich erinnerte mich an einige meiner Bemerkungen über die Pest, dass Ansteckung von derselben durch Tragen künstlicher Ableitungen (Fontanell) verhütet worden sei, brachten mich darauf, ähnliches zu versuchen. ….. Ich schnitt mir ein Fontanell am linken Arm und legte auch zuweilen, wenn es nicht thätig genug eiterte, ein Vesicatorium perpetuum im Nacken. ….. Fünf Monate führte ich so die Direction des Spitals, in welchem ich täglich drei bis vier Stunden verweilte, und wirklich blieb ich die ganze Zeit gesund, während ich neben mir mehrere Unterärzte, Chirurgen und Apotheker am Typhus verlor, welche ähnliches Vorbauen verschmähten. Erst nach der Schlacht, wo alle Verhältnisse so wüst und zerstört waren, dass ich auch Fontanell und Vesicatorien nicht mehr verband und alles dieses geheilt war, meldeten sich plötzlich die Krankheitssymptome und bald lag ich bewusstlos.“(15, S. 91).
Während dieser einundzwanzigtägigen Bewusstlosigkeit wurde er von seinem Kollegen Clarus behandelt. Lange widersetzte sich dieser der mit letzter Kraft vorgebrachten Bitte seines Patienten nach einem Bad, um angesichts fehlender Hoffnung für ihn dieses schließlich doch noch zu erlauben. Überraschend setzte aber bei Carus danach langsam eine Besserung ein, die ihn jedoch erst im Frühjahr 1814 wieder völlig genesen ließ (15, S. 115).
Wir begegnen dieser Idee der Ausleitung von Giften durch Techniken wie dem Aderlass, Schröpfen oder dem Anlegen von Fontanellen als Bestandteil der Humoralpathologie, der Säftelehre. Diese stand neben der bereits in der Antike erkennbaren kontagionistischen Sichtweise. Von einer generellen Therapie konnte, trotz des gut beschriebenen Krankheitsverlaufes, damals freilich noch nicht gesprochen werden. Einzig die Isolation der Erkrankten und die Einhaltung hygienischer Mindestanforderungen waren von Nutzen.
So beklagt Carus auch in seinen Erinnerungen, wie „gering ein menschliches Dasein oft auf der großen Rechentafel der Welt zu zählen ist.“ (15, S. 104). Er verweist ferner darauf, dass „die Schriften von Schelling, Oken, Troxler und anderer nicht ohne Einfluss auf seine physiologisch-philosophische Richtung geblieben“ seien (15, S. 107). Carus, der aus seiner gewohnten akademischen Umgebung herausgerissen worden war, sah sich plötzlich der „Hilflosigkeit der Medizin unter militärischen Bedingungen“ ausgesetzt und bezeichnet den Krieg als „Missachtung der Menschheit an Massen.“ Und er klagt weiter: „Ein reiches Land gab hier die Blüte seiner jungen Mannschaft her, Tausende von Familien mussten hierher senden, was lange Jahre mit Liebe und Sorgfalt und voller Hoffnung von ihnen gepflegt worden war, und wie sorglos wurde damit umgegangen!“ (15, S. 122).
Carus gestattet uns damit einen kurzen Einblick in sein Denken, das von tradierten ethischen Berufsauffassungen geleitet war und so ganz sicher auch für viele seiner Kollegen zum Motiv ihres selbstlosen Handelns geworden sein dürfte.
Welche Bilanz kann man heute aus der Völkerschlacht ziehen?
Statistisch gesehen zählt sie mit ihren insgesamt 125 150 Gefallenen, Verwundeten und Kranken zu den verlustreichsten der napoleonischen Kriege.
Davon hatten die Alliierten 80 150 (26,2 %) und Napoleons Truppen 45 000 (24,7 %) Verluste, wie Vollstädt in seiner Analyse ermitteln konnte (5, S. 105 und 108).
Allein diese Angaben lassen uns die enorme Belastung für die Ärzte und das gesamte Sanitätspersonal beider Seiten in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht erahnen und vielleicht auch verstehen. Lange vor dem Zeitalter der Fotografie, verdanken wir allein der bildenden Kunst einen, allerdings nur ungefähren Eindruck, der aussichtslosen Lage vieler Verwundeter und Kranker, wozu auch die katastrophalen Verhältnisse auf dem damaligen Johannisfriedhof zu zählen sind. Dort hatten die französischen Gefangenen die Grüfte aufgebrochen und sie ihres Inhaltes entledigt, um sich darin vor Kälte zu schützen (Abb. 5). Eine solche die ganze Stadt erfassende Belastung muss für alle Betroffenen, ganz gleich ob Freund oder Feind, ungeheuer gewesen sein. Folglich entzieht sie sich uns einer realistischen Bewertung, trotz unserer Vertrautheit mit dem gegenwärtigen, vorwiegend militärmedizinisch relevanten posttraumatischen Stressgeschehen.
Vielleicht verdienen diese Zeugnisse ärztlichen Handelns, Ausdruck eines ebenso hohen Berufsethos wie vielleicht auch patriotischer Haltung, gerade deshalb den besonderen Respekt nachfolgender, dem Erhalt des Lebens verpflichteter Generationen.
*Vortrag im AK „Geschichte und Ethik der Wehrmedizin“ beim 44. Kongress der „Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie“ am 11.10.2013 in Warnemünde
Literatur
- Tarle E: Napoleon. Deutscher Verlag d. Wiss., Berlin 1969.
- Helmert H, Uszeck H-J: Europäische Befreiungskriege 1808-1813/15. Militärverlag, Berlin (2) 1989.
- Dohm K: Die Typhusepidemie in der Festung Torgau 1813-1814. Inaug. Diss., Leipzig, in: Düsseldorfer Arbeiten zur Geschichte der Medizin. Bd. XI. –Triltzsch Verlag, Düsseldorf 1987, 5.
- Furter H-J, Lemmens F-J, Spitzner R: Hygienisch-epidemiologische Aspekte der Völkerschlacht. Z Militärmed 1989; 30: 4.
- Vollstädt K und R: Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 – Analysen und Wertungen militärmedizinhistorischer Sicht. Med. Diss., Leipzig 1989.
- Grundmann RT: Dominique Jean LARREY, „revolutionärer“ Chirurg in Napoleons Diensten, in: CHAZ 2011; 12: 3.
- Mechler A: Das Wort „Psychiatrie“. Historische Anmerkungen. Nervenarzt. 1963; 34.
- Stadtarchiv Leipzig (im Folgenden: StA-L): Acta, die militärischen Ereignisse im Jahre 1813 betreffend. Tit. Akten, Vol. IX, LVII.B. 87 i.
- StA-L, ebenda, LVII.B. 87 h.
- Lutze G.: Die ersten chirurgischen Demonstratoren am neuerrichteten klinischen Institut des Jakobs-Spitals zu Leipzig. Inaug. Diss., Leipzig 1944.
- Kästner I, Thom A (Hrsg.): 575 Jahre Medizinische Fakultät der Universität Leipzig. Leipzig 1990.
- StA-L, ebenda, LVII. B. 87 a.
- Naumann R: Aus dem Jahre 1813. Mitteilungen. Leipzig 1869.
- SKH Dr. Albert Prinz von Sachsen Herzog von Sachsen: Carl Gustav Carus und seine Freundschaft mit König Johann von Sachsen. In: http//www. Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Studiengruppe für die Sächsische Geschichte und Kultur e. V.
- Carus CG: Erfahrungsresultate aus ärztlichem Studium und ärztlichem Wirken eines halben Jahrhunderts. Bd.1, Leipzig 1859.
Bildquelle: Alle Abbildungen wurden mit freundlicher Genehmigung vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig überlassen.
Danksagung
Ein besonderer Dank sei gesagt Herrn Dipl.-Bibliothekar Marko Kuhn vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, aber auch dem Stadtarchiv Leipzig und dem Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Universität Leipzig.
Datum: 03.02.2014
Wehrmedizinische Monatsschrift 2013/12